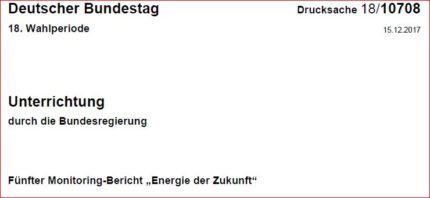Ancilla Juris hatte im Oktober 2016 drei Arbeiten zur rabbinischen Interpretationskultur veröffentlicht.[1] Sie waren für mich Anlass, noch einmal Marietta Auers Abhandlung »Der Kampf um die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft – Zum 75. Todestag von Hermann Kantorowicz«[2] zu lesen. Kantorowicz hat verglichen mit seinen »weitgehend auserforschten Zeitgenossen« (S. 804) Kelsen, Radbruch und Hart in der Tat eine neue Würdigung verdient, und zwar nicht nur als Wiedergutmachung für das ihm in Kiel widerfahrene Unrecht. Ich habe selbst als Student in Kiel noch die Reste der »Stoßtruppfakultät« in der Person von Georg Dahm und Karl Larenz erlebt. Dahm war ein begeisternder Redner, für den kein Hörsaal groß genug war. Larenz schaffte es, jeden Hörsaal leer zu predigen. Aber sein »Schuldrecht« war uns Offenbarung. Aus heutiger Sicht bedrückt mich unsere oder meine politische Naivität. Wir wussten zwar, dass Kantorowicz (und Radbruch) von den Nazis aus Kiel vertrieben worden waren. Aber wir kamen gar nicht auf die Idee, von Dahm oder Larenz handfest Rechenschaft zu fordern.
Als einzige Wiedergutmachung, die für Kantorowicz heute noch möglich ist, bleibt die wertschätzende Auseinandersetzung mit seinem wissenschaftlichen Werk, wie Auer sie unternommen hat. Auers Kantorowicz-Interpretation wird zwar kaum verhindern, dass sein Werk nur noch als Zitatenschatz geplündert wird. Nicht jeder will oder kann selbst immer wieder die Klassiker lesen, auf deren Schultern die heutige Jurisprudenz steht. Aber Auers Referat und Würdigung sind da ein guter Ersatz.
Meine Zustimmung endet allerdings bei der Art und Weise, in der Auer Grundgedanken der Freirechtslehre von Kantorowicz als Angriff auf die »Legitimationskraft gebundener Rechtsanwendung« (S. 794) interpretiert. Den Schlüssel findet sie im jüdischen Recht, dem sie das Paradigma einer transnationalen Rechtsordnung entnimmt (S. 789), um in der Freirechtslehre von Kantorowicz die »Theorie eines interpretativen Rechtspluralismus« (S. 797) zu entdecken. Das ist eine ebenso starke wie unhaltbare These.
Man kann schon darüber streiten, ob es überhaupt angebracht ist, für die Würdigung einer wissenschaftlichen Leistung auf die jüdische Abstammung des Autors zu verweisen[3] oder ob es nicht besser wäre, das Werk aus sich heraus zu verstehen und zu würdigen, das um so mehr, als sich Kantorowicz selbst vom Judentum losgesagt hatte. Nachdem aber mit dem gehörigen Atlantic lag von über 20 Jahren der turn to the jewish legal model[4] auch Deutschland erreicht[5] hat, lag auch in seinem Falle der Rückgriff auf jüdische Theologie und Interpretationspraxis nahe.
Für die Rechtstheorie ist der Rückgriff auf jüdisches Recht wie auch auf andere religiöse Rechte von vornherein prekär. Anleihen bei bekenntnisgebundenen Theologien, seien sie nun jüdisch oder christlich, muslimisch oder hinduistisch, sind schlechte Vorbilder, denn für Pluralismus aller Art waren und sind die Religionen – jedenfalls pauschal und aus der Distanz betrachtet – ein Desaster. Sie eignen sich schon gar nicht als Kontrast zu einer sich als gebunden verstehenden Gesetzesauslegung, ist doch die Bindung an den göttlichen Gesetzgeber stärker noch als diejenige an den säkularen, und der Umgang mit den heiligen Büchern spottet allen texttheoretischen Einsichten.
Bei der Rezeption fremddisziplinärer Gedanken zur Leitfähigkeit von Texten haben Juristen schon öfter tüchtig übertrieben. Das gilt sowohl für die Sprachphilosophie wie für die verschiedenen Rezeptionstheorien[6]. Zu Übertreibungen führt auch die Rezeption jüdischer Modelle durch die Rechtstheorie. Aber der Rückgriff auf das jüdische Recht ist en vogue, denn hier glaubt man, ein historisches Beispiel für »ein Recht ohne Staat, ja gegen den Staat«[7] zu finden, und zwar ein Beispiel, dem, weil es jüdisch ist, eine Aura[8] eigen ist.
Auer gründet ihr Argument auf die berühmte Parabel vom Ofen des Achnai. Darin geht es um die als solche absolute und unbestrittene Autorität Gottes, die aber nicht greifbar ist, so dass die Auslegung seines Gesetzes den menschlichen Interpreten überlassen ist. Als solche haben sich alsbald die Rabbiner[9] etabliert, die nach Ortsgemeinden organisiert sind und, jedenfalls im Prinzip, keine Hierarchie kennen. Dazu kommt das Mehrheitsprinzip. In der Parabel bringt Rabbi Josua die Sache auf den Punkt: »Wir achten auf keine Stimme des Himmels, denn in deinem Gesetzbuch auf dem Berge Sinai hast du (Gott) selbst gelehrt: ›Nach der Menge (Stimmenmehrheit) sollst du dich neigen.‹[10]« Ohne Nachhilfe von Rabbi Josua hätte ich die einschlägige Bibelstelle genau umgekehrt als Warnung vor dem Mehrheitsprinzip verstanden. Tatsächlich gilt aber im Judentum wohl bis heute das Prinzip der Mehrheit und der weitgehenden Autonomie der Rabbiner vor Ort[11].
Diese jüdische Tradition der pluralen Interpretation mag innerjüdisch relativ erfolgreich (gewesen) sein. Stone, auf die Auer sich mehrfach bezieht, meint allerdings, es werde da eher ein Wunschbild gezeichnet, und selbst ein genaueres Bild sei auf eine säkulare Gesellschaft kaum übertragbar. Die Realität des Judentums ist wohl immer noch näher an dem Gebot der strikten Wortauslegung, die dem 5. Buch Mose Kap 4 Vers 2 entnommen wird (vgl. Auer bei Fn. 84). Es bedarf keiner »paradoxen« autoritativen Verweisung[12], um das säkulare Gesetz der interpretatorischen Vernunft zu öffnen. Es ist kein Zufall, dass eine (m. E. falsch verstandene[13]) Digestenstelle zum Motto der Freirechtsschule geworden ist: »Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat«. Die »richtige Interpretation« von Bibel, Talmud oder Koran »wäre eine versteckte Form der Verkörperung der Stimme Gottes, die niemals anwesend sein kann«[14]. Der staatliche Gesetzgeber ist dagegen nicht, wie Auer sagt, »radikal abwesend« (S. 795), sondern im Gegenteil in vieler Hinsicht anwesend.
Im Zusammenhang mit dem Freirecht weckt die Parabel vom Ofen des Achnai falsche Konnotationen, denn ihr liberaler Geist hat die Entwicklung des orthodoxen Judentums zu einer autoritätsgläubigen Gesetzesreligion nicht verhindert. Dazu haben vor allem kanonische Texte und einer Hierarchie der Auslegungen beigetragen.[15] In Thora, Mischna und Talmud sind dem jüdischen Recht Autoritäten erwachsen, auf die Kantorowicz‘ Methodenkritik leicht übertragen werden könnte.
In der Kollision mit nichtjüdischen Pluralitäten war rabbinische Interpretation ohnehin machtlos. Angesichts des talmudischen Dina-de-Malchuta-Dina Prinzips[16] liegt es besonders fern, jüdische Interpretationstraditionen für die Rechtstheorie heranzuziehen. Schon gar nicht taugen sie zum Beleg, dass tatsächlich ein transnationaler oder sonst irgendein Rechtspluralismus ohne hierarchische Bindung heranwächst. Der Verweis auf das jüdische Rechtsmodell hilft jedoch, an dem Phantom einer Staatlichkeit zu bauen, das in der Diskussion eine ähnliche Funktion einnimmt wie die Contra-legem-Fabel für die Freirechtsschule. In der Regel trägt dieses Phantom heute den Namen epistemischer Etatismus. Bei Auer handelt es sich um »das das herkömmliche Modell der Begründung rechtlichen Sinns durch staatszentrierte, autoritative Normsetzung und an deren Legitimationskraft gebundene Rechtsanwendung« (S. 794).
Es mag ja sein, dass die rabbinische Interpretationskultur über »vernunftbegründende Qualität« (S. 796) verfügt. Es ist aber nicht einzusehen, warum die Bemühung um Gesetzesnähe »Irrationalität und Richterwillkür« (S. 796) bedeuten sollen. Gesetzesbindung und interpretatorische Vernunft sind keine Gegensätze. Das Bemühen um Gesetzesnähe bleibt weit hinter dem theologischen Anspruch auf eine letztlich göttlich autorisierte Auslegung zurück. In diesem Sinne meint Stone S. 821, das rechtstheoretische Interesse an jüdischem Recht ignoriere dessen religiöses Element. Ein jüdisches Gesetz »in Abwesenheit göttlicher Autorität« ist schwer vorstellbar. Man könnte vielleicht erwidern, dass dieser Einwand den Witz der Parabel vom Ofen des Achnai verfehlt. Mit Stone (S. 818) würde ich darauf replizieren, dass die Parabel in der Tat für ein liberales Rechtsmodell steht, dass die Rechtstheorie in der jüdischen Tradition aber viel eher ein Gegenmodell vorfindet.
Was den Angriff auf das von ihm so genannte Werkzeugdogma betrifft, hat Kantorowicz auf ganzer Linie gesiegt, so dass es keiner Stützung durch die Ofen-Parabel bedarf. Interessant ist heute vielmehr, wie denn positiv die auch von Kantorowicz als solche nicht geleugnete Richterbindung (S. 785f, 797) ausgefüllt werden kann. Dazu hat Philipp Heck wohl doch mehr beigetragen, als Auer (S. 798f) ihm konzediert. Während Auer 2008 zum 150. Geburtstag von Philipp Heck die von Heck dem Richter zugebilligte Freiheit »frappierend« nannte, spricht sie nun von der »strikt auf Richterbindung im Sinne der subjektiven Theorie bedachten Interessenjurisprudenz« (S. 798). Während Auer 2008 noch Hecks Leistung als »die bis heute unangreifbare wissenschaftliche Fundierung der juristischen Methodenlehre auf empirisch-rationaler Basis« gewürdigt hatte, erfahren wir jetzt, die Interessenjurisprudenz sei »korrumpierbar«, soweit sie ihre Ergebnisse dem Willen des Gesetzgebers zuschreibe. Der kurze Absatz, in dem Kantorowicz 1928 auf die Interssenjurisprudenz eingeht[17], lässt sich schwerlich als »konsequente Abgrenzung Kantorowicz’ gegenüber der Interessenjurisprudenz … deuten« (S. 799 Fn. 90). Muschelers Darstellung[18], auf die Auer als »differenzierend zum Verhältnis zwischen Freirecht und Interessenjurisprudenz« verweist, zeigt viel eher, dass Kantorowicz letztere nicht voll gewürdigt hat.
Auers Gewährsmann für die Relevanz jüdischer Rechtskultur für moderne Rechtstheorie ist Robert M. Cover[19]. Cover hat ganz fraglos die Aufmerksamkeit der Rechtstheorie auf das jüdische Recht gerichtet. Covers Ausgangspunkt in »Nomos and Narrative« ist, sieht man von der Wortwahl ab (Nomos, normatives Universum, Jurisgenesis, Narrative, jurispathisch), leidenschaftlich oder gar pathetisch vorgetragen, in der Sache aber nicht wirklich originell. Dass »staatliches Recht stets nur einen Teil des … ›normativen Universums‹ ausmacht (S. 795), wer wollte das bestreiten? Aber Cover überhöht das Universum normativer Sinnsphären, indem er ihm den mit Konnotationen gesättigten Namen Nomos verleiht. So scheinen kulturelle und religiöse Ordnungen mit staatlichem Recht auf Augenhöhe miteinander zu konkurrieren. Augenhöhe ist der falsche Ausdruck, denn er impliziert gleiche Qualität und Würde. An beidem mag das staatliche Recht außerrechtlichen Ordnungen oft unterlegen sein. Und in vielen Einzelfällen mag man beklagen, dass staatliches Recht gesellschaftliche Sinnvorstellungen bedrängt. Aber viel stärker bedrängen sich gesellschaftliche Sinnvorstellungen gegenseitig. Es gibt wohl Enklaven gesellschaftlicher Selbstorganisation und Rechtsbildung. Die Rechtssoziologie ist seit Jahrzehnten danach auf der Jagd, ihre Beute kümmerlich.
Bei der Auseinandersetzung mit literaturwissenschaftlichen Rezeptionstheorien bin ich auf Louise Rosenblatt[20] gestoßen, die in den USA mindestens so renommiert ist wie Stanley Fish. (Autorität ist ein Argument.) Sie weist auf die Interessen und Absichten hin, die der Leser an einen Text heranträgt. Handelt es sich um ein praktisches Leseinteresse, so lässt sich der Text durchaus als Informationsquelle nutzen. Dagegen geht Auer davon aus, dass eine subjektive Auslegung zwangsläufig mit einem fundamentalistischen Autoritätsinteresse verbunden sei. Das mag ja gelegentlich (immer noch) zutreffen. Aber zentral dürfte heute der Glaube an die Legitimationskraft der Funktionalität einer gebundenen Rechtsanwendung sein.
Heute haben mehr oder weniger alle Juristen – auch von Kantorowicz – gelernt, ihre Interpretationsleistung nicht hinter autoritärer Beglaubigung zu verstecken. Der Streit hat sich auf die Frage verlagert, ob das Recht in dem Sinne »Teil eines normativ pluralistischen Sinnuniversums ist«, »dass der Kanon der Rechtsquellen … mehr umfassen muss als formelles und materielles staatliches Recht.« Diese Frage würde ich im Sinne eines »weichen« oder »state legal pluralism« (Michaels[21], Twining[22]) beantworten.[23] Nur eine ordnende Hierarchie ist in der Lage, einen positiven Pluralismus zu bewahren. Positiver und negativer Pluralismus (David E. Apter)[24], das ist der Gegensatz, auf den zu konzentrieren sich heute lohnen könnte.
Nachtrag vom 10. 11. 2017: An der Universität in Kiel gibt es ein Hermann Kantorowicz-Institut für juristische Grundlagenforschung. Das veranstaltet am 17. und 18. November 2017 eine Internationale Tagung – Hermann Kantorowicz’ Begriff des Rechts und der Rechtswissenschaft. Ein Manuskript von Ino Augsberg über »Hermann Kantorowicz und die Freiheit des Rechts« soll 2018 in dem Band »350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel« bei Mohr Siebeck erscheinen. Darin setzt sich Augsberg kritisch mit Mariettas Auers Aufsatz von 2015 auseinander.
_____________________________________________
[1] Ronen Reichmann, Autorität, Tradition, Argumentation bei der Formierung des rabbinischen Rechtsdiskurses, Ancilla Iuris , 2016, 87-110; Karl-Heinz Ladeur, Report zu Ronen Reichman »Autorität, Tradition, Argumentation bei der Formierung des rabbinischen Rechtsdiskurses«, Ancilla Iuris , 2016, 111-120; Daniel Loick, Report zu Ronen Reichman »Autorität, Tradition, Argumentation bei der Formierung des rabbinischen Rechtsdiskurses«, Ancilla Iuris 2016, 121-132.
[2] ZEuP 2015, 773-805. Darauf beziehen sich die Seitenangaben im Text.
[3] Wie 1936 der von Auer (S. 790) deshalb gerügte Philipp Heck in dem Aufsatz »Die Interessenjurisprudenz und ihre neuen Gegner« (AcP 142, 129-202).
[4] Suzanne Last Stone, In Pursuit of the Counter-Text: The Turn to the Jewish Legal Model in Contemporary American Legal Theory, Harvard Law Review 106, 1993, 813-894.
[5] Karl-Heinz Ladeur/Ino Augsberg, »Der Buchstaben tödtet, aber der Geist machet lebendig«? Zur Bedeutung des Gesetzesverständnisses der jüdischen Tradition für eine postmoderne Rechtstheorie, Rechtstheorie 40, 2009, 431-471; dies. (Hg.), Talmudische Tradition und moderne Rechtstheorie, Kontexte und Perspektiven einer Begegnung, 2013; Andreas Fischer-Lescano, Regenbogenrecht. Transnationales Recht aus den »Quellen des Judentums«, in: Julia König und Sabine Seichter (Hg.), Menschenrechte. Demokratie. Geschichte. Transdisziplinäre Herausforderungen an die Pädagogik (2014).
[6] Zu Aufnahme literaturwissenschaftlicher Rezeptionsheorien in der Rechtswissenschaft vgl. die Einträge vom 25. Mai 2015 (Ein Carl Schmitt der Literaturwissenschaft und die Rechtstheorie: Hans Robert Jauß), vom 1. Juni 2015 (Konvergenzen und Divergenzen zwischen juristischer Methodenlehre und Literaturtheorie), vom 29. Juli 2015 (Zur Konvergenz von Rezeptionsästhetik und Reader-Response-Theorie) und vom 12. August 2015 (Zur Rezeption literaturwissenschaftlicher Rezeptionstheorien durch die Rechtstheorie).
[7] Marc Amstutz/Vaios Karavas (Rechtsmutation. Zu Genese und Evolution des Rechts im transnationalen Raum, Rechtsgeschichte 8, 2006, 14-32) finden im jüdischen Recht ein Modell für alternatives Recht, insbesondere für transnationales Recht. Ähnlich Thomas Vesting, Rechtstheorie als Medientheorie (Supplement I), Ancilla Juris 2010, 47-88, S. 48.
[8] »Aura« ist selbst ein durch Walter Benjamin jüdisch konnotierter Begriff, der längst seinerseits eine Aura erworben hat, von der vermutlich jeder, der sie anführt, profitiert. Und der Begriff bleibt, auch wenn man noch einmal Benjamins Text nachliest, so offen, dass sich jeder seinen eigenen Reim darauf machen kann. Mein Reim ist eine emotional positiv besetzte Faszination, die freilich vor der Strenge der Orthodoxie Halt macht.Darin hat mich zuletzt »Die Hochzeit der Chani Kaufman« von Eve Harris bestärkt.
[9] Ihre Kompetenz leiten sie aus dem 5. Buch Mose 17, 8-11, her.
[10] Gemeint ist 2. Mose 23, 2. In der so genannten Einheitsübersetzung: »Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist, und sollst in einem Rechtsverfahren nicht so aussagen, dass du dich der Mehrheit fügst und das Recht beugst.«
[11] Eine kurze Darstellung, die gleichfalls an die Geschichte vom Ofen des Achnai anknüpft, gibt die Rabbinerin Gesa Ederberg in der Jüdischen Allgemeinen vom 28. September 2014: »Es gibt keine direkte Offenbarung Gottes in der Gegenwart. Mit der Zerstörung des Tempels hat die direkte Prophetie aufgehört. Zum anderen wird das Mehrheitsprinzip innerhalb der rabbinischen Kreise etabliert. Es gibt keinen Großrabbiner, der alles entscheiden kann, wie es ja auch keinen Sanhedrin, keinen obersten Gerichtshof mit Autorität über alle, mehr gibt. Bis heute gilt im Judentum das Prinzip der Mehrheit und der weitgehenden Autonomie des Rabbiners oder der Rabbinerin vor Ort.«
[12] Auer S. 794; Daniels S. 132.
[13] Dazu der Eintrag vom 11. Noember 2015 Das Motto des Freirechts: »Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat«.
[14] Ladeur/Augsberg, Rechtstheorie 40, 2009, 431/442.
[15] Justus von Daniels, Religiöses Recht als Referenz, 2009, S. 138ff.
[16] Rabbiner Jehoschua Ahrens, Dina de Malchuta Dina, Religiöse Begriffe aus der Welt des Judentums (2014): »Das talmudische Prinzip Dina-de-Malchuta-Dina (»das Gesetz des Landes ist Gesetz«) schreibt vor, dass Juden grundsätzlich verpflichtet sind, die Gesetze des Landes, in dem sie leben, zu respektieren und zu befolgen. Das bedeutet auch, dass diese in bestimmten Fällen sogar der Halacha, dem jüdischen Gesetz, vorzuziehen sind.«
[17] Hermann U. Kantorowicz/Edwin W. Patterson, Legal Science – A Summary of Its Methodology, Columbia Law Review 28, 1928, 679-707, S. 706f.
[18] Karlheinz Muscheler, Relativismus und Freirecht. Ein Versuch über Hermann Kantorowicz, 1984, S. 142-151.
[19] Ihm habe ich bereits zwei Einträge gewidmet: Robert M. Cover und seine Jurisprudenz der Leidenschaft und des Widerstands, Teil I und Teil II.
[20] Eintrag vom 29. Juli 2015, insbesondere bei Fußn. 10.
[21] Ralf Michaels, The Re-State-ment of Non-State-Law: The State, Choice of Law, and the Challenge from Global Legal Pluralism, Wayne Law Review 51, 2005, 1209-1259.
[22] William Twining, Globalisation and Legal Theory, 2000, S. 225; ders., Normative and Legal Pluralism: A Global Perspective, Duke Journal of Comparative and International Law 20, 2010, 473-517.
[23] Als Vorläufer kann man lesen Robert Scheyhing, Pluralismus und Gneralklauseln – betrachet auf dem Hintergrund geellschaftlichen Wandels, 1976.
[24] Dazu der Eintrag Die Einfalt der Vielfalt: Von der organischen zur normativen Solidarität.