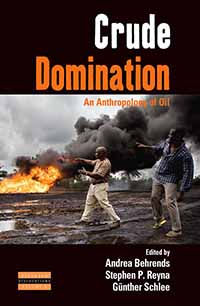Seit Tagen sitze ich über dem Entwurf zu § 78 von Rechtssoziologie-online, der die Korruption behandeln soll. Die Literatur ist unermesslich. Das meiste ist überflüssig. Doch nach und nach kristallisieren sich einige Text heraus, die gehaltvoller sind als die Masse. Einer davon ist Modernization and Corruption von Samuel P. Huntington. Es handelt sich ursprünglich um die S. 59-71 aus Huntingtons Buch »Political Order in Changing Societies, 11. Aufl., New Haven [u.a.] 1976 [1967], der auch separat als Beitrag in dem von Arnold J. Heidenheimer u. a. herausgegebenen Handbuch »Political Corruption« erschienen ist. Huntington führt darin die These aus, ein größeres Maß an Korruption bilde eine unvermeidbare Begleiterscheinung im Modernisierungsprozess:
»Corruption may be more prevalent in some cultures than in others but in most cultures it seems to be most prevalent during the most intense phase of modernization … Impressionistic evidence suggests that its extent correlates reasonably well with rapid social and economic modernization.« (1976, 59)
Der Anwendungsbereich dieser These ist nicht auf die Entwicklungsländer beschränkt. Huntington hat sie auch auf die Modernisierung der USA und Englands im 19. Jahrhundert bezogen. Vier Gründe hat er für seine These angeführt:
Erstens: Im Zuge der Modernisierung ändern sich grundlegende Werte und Einstellungen. Mit dem Übergang von der traditionalen zur modernen Gesellschaft steigt die Akzeptanz universalistischer und leistungsbezogener Normen. Die Menschen identifizieren sich zunehmend mit ihrem Staat, demgegenüber jeder gleichermaßen verpflichtet ist. Erst aus dieser modernen Sicht kann ein Verhalten, das nach traditionellen Vorstellungen entspricht, als korrupt wahrgenommen werden. Eine Folge ist, dass Verhaltensweisen, die traditionell als selbstverständlich galten, insbesondere Nepotismus, nunmehr verpönt sind.
Zweitens: Ein wichtiger Aspekt dieses Wandels ist die Ausdifferenzierung einer öffentlichen privaten Sphäre. Solange alles »privat« war, war Korruption undenkbar.
Drittens: Mit der Modernisierung kommen neue Quellen für Reichtum und Macht. Dazu gehört auch der Aufbau staatlicher Strukturen, die den Zugriff auf Ressourcen ermöglichen, an denen man sich bereichern kann. Die Reichen versuchen, ihre Ressourcen in politische Macht umzusetzen. Die politisch Mächtigen versuchen, sich zu bereichern.
Viertens: Die zunehmende Verrechtlichung schafft sozusagen erst die opportunity structure für Korruption.
Die erste These, die ich Unvermeidbarkeitsthese nennen will, stützt Huntington durch eine zweite über die Funktionalität von Korruption im Modernisierungsprozess.
Das klingt so abstrakt referiert vielleicht nicht besonders eindrucksvoll, wird aber durch eine ganze Reihe empirisch gehaltvoller und jedenfalls anekdotisch belegter Hypothesen interessant und relevant. Deshalb sollen die konkreten Hypothesen, mit denen Huntington seine abstrakten Thesen unterlegt, jedenfalls angedeutet werden. Über einige kann man ab initio streiten, jede einzelne bedarf der Prüfung und manche dürften im Ergebnis unhaltbar sein. Aber eine solche Sammlung prägnanter Hypothesen in einem relativ so kurzen, klar geschriebenen Text – das mache ihm erst einmal jemand nach.
1) In den USA ebenso wie in England war das 19. Jahrhundert viel stärker von Korruption geprägt als das 18. und das 20. (S. 59)
2) Korruption in der Modernisierungsphase darf man nicht als individuell abweichendes Verhalten interpretieren. Es geht vielmehr um den Konflikt zwischen neuen und den etablierten Normen. (S. 60)
3) Werden traditionelle Normen in Frage gestellt, so verlieren Normen überhaupt an Legitimität. (S. 60)
4) Der Konflikt zwischen traditionellen und modernen Normen eröffnet für den Einzelnen Handlungsmöglichkeiten, die weder aus der einen noch aus der anderen Sicht legitimiert sind. (S. 60)
5) Wird Leistungsorientierung zum neuen Standard, so führt das zunächst zu größerer Identifizierung mit der Familie und folglich dem Wunsch, Familieninteressen gegenüber der neuartigen Bedrohung zu schützen. (S. 60)
6) Korruption der Reichen: Gewinnen im Zuge der Modernisierung neue Gruppen Reichtum, so bietet Korruption ihnen einen Zugang zur Politik. (S. 61)
7) Korruption der Armen: Die Massen, die im Zuge der Modernisierung das Wahlrecht erhalten, tauschen ihre Stimme gegen politische Versprechen. (S. 61)
8) Das Ausmaß, in dem die durch Verrechtlichung aufgebaute Opportunity-Structure für Korruption genutzt wird, hängt davon ab, wieweit das Recht von der Bevölkerung akzeptiert ist, wie leicht Verstöße verborgen bleiben und welchen Gewinn sie versprechen. (S. 62)
9) Zoll- und Steuergesetze, Gesetze zur Regulierung des Handels und besonders verbreiteter und profitabler Aktivitäten wie Glückspiel, Prostitution und Drogen sind besonders korruptionsanfällig. (S. 62)
10) Werden im Zuge der Modernisierung durch politische Entscheidungen und Gesetze bestimmte Gruppen zurückgesetzt, so wehren sie sich durch Korruption. ( S. 62)
11) Der mit der Modernisierung verbundene Norm- und Wertewandel wird in der Regel zunächst von Studenten, Militärs und anderen (Akademikern?) rezipiert, die im Ausland waren. (S. 60)
12) Die Protagonisten der Modernisierung in einem Entwicklungsland treiben ihre Norm-und Wertvorstellungen oft auf die Spitze. Ihre Einstellung kommt damit dem Fanatismus gleich, der im Anfangsstadium vieler Revolutionen und mancher Militärregime zu beobachten ist. (S. 62)
13) Die puritanische Übertreibung neuer Standards führt zur Abwertung und Zurückweisung von Verhandlung und Kompromiss in der Politik und eventuell sogar dahin, dass Politik schlechthin mit Korruption identifiziert wird. (S. 62)
14) Eliten auf dem Modernisierungspfad sind nationalistisch und betonen die alles überragende Bedeutung des Gemeinwohls. (S. 62)
15) Die überzogene Antikorruptions-Mentalität hat ähnliche Folgen wie die Korruption selbst: Beide richten sich gegen die Autonomie der Politik. Die Korruption ersetzt politische Ziele durch private Interessen, der Antikorruptionsgestus ersetzt Politik durch Technokratie, die dem Gemeinwohl wenig nützt. (S. 63)
16) Bei der Ächtung der Korruption geht es manchmal inkonsequent zu. Was gemeint ist zeigt das Beispiel: Zu einem bestimmten Zeitpunkt akzeptierte man in England zwar den Kauf von Botschafterposten, nicht jedoch den Kauf von Adelstiteln, in den USA wiederum zwar den Kauf von Boschafterposten, nicht jedoch den von Richterstellen. (S. 63)
17) Mit der Korruption steht es sowohl hinsichtlich der Ursachen als auch hinsichtlich der Wirkungen ähnlich wie mit der Gewalt. Beide zeigen eine Schwäche der politischen Institutionen an. (S. 63)
18) Eine Gesellschaft die zur Korruption neigt, neigt auch zur Gewalttätigkeit. Korruption und Gewalt können sich wechselseitig ersetzen, noch öfter treten sie zusammen auf. (S. 63f.)
19) Korruption ersetzt ein Verhandlungsergebnis. Gewalt ersetzt einen politischen Konflikt. (S. 64)
20) Sowohl Gewalt als auch Korruption stellen illegitime Forderungen an das politische System. Korruption führt oft auch zur Erfüllung solcher Forderungen. Gewalt bleibt eher eine unerwiderte Geste des Protests. (S. 64)
21) Gewalt ist noch schädlicher als Korruption. (S. 64) Wer die Polizei nur besticht, scheint sich immerhin mit deren Existenz abzufinden, anders als derjenige, der die Polizeiwache stürmt. (S. 64)
22) Korruption kann Gruppen, die sonst vom politischen Verteilungskampf ausgeschlossen wären, zu Vorteilen verhelfen, die verhindern, dass sie sich der Gesellschaft entfremden. Insofern kann Korruption ähnlich wie eine Reform der Erhaltung des politischen Systems dienen und vielleicht sogar eine Revolution abwenden. (S. 64)
23) Eine in sich homogene vormoderne Gesellschaft entwickelt im Zuge der Modernisierung weniger Korruption als eine Gesellschaft, in der unterschiedliche Traditionen und Werte konkurrieren.
24) Ist eine vormoderne Gesellschaft durchgehend in Kasten und Klassen geschichtet, entwickelt sie im Zuge der Modernisierung weniger Korruption als eine egalitäre Gesellschaft, weil das System der Schichtung stark normiert zu sein pflegt. Die Modernisierung feudaler Gesellschaften geht daher mit weniger Korruption einher als diejenige von zentralisiert verwalteten. Daher z. B. in Japan weniger Korruption als in China. (S. 64f., 66)
25) Staaten, in denen die Stimmabgabe vor allem entlang von Klassengrenzen erfolgt England, Australien), haben weniger Korruption gezeigt als andere (USA, Kanada). (S. 65)
26) Eine Regierung, die sich aus einer Oberklasse mit einem Ehrenkodex rekrutiert, ist weniger bestechlich als eine Regierung aus Aufsteigern. (S. 65)
27) In einer Gesellschaft, die gute Aufstiegsmöglichkeiten bietet wie in den USA, führt der Weg zur Politik über das Geld. In einer Gesellschaft ohne die Möglichkeit, Vermögen zu erwerben, führt der Weg zum Geld über die Politik.
28) Die Anwesenheit ausländischer Investoren in einem Entwicklungsland fördert die Korruption, weil diese weniger Skrupel haben, die lokalen Normen zu verletzen, aber auch, weil sie die Wirtschaft soweit im Griff haben, dass die Einheimischen den Weg zum Reichtum über die Politik suchen müssen. (S. 66)
29) Nur in Ländern mit sehr schwachen Institutionen und fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten (Beispiele aus Afrika sowie Mittel- und Südamerika) sind gerade auch die oberen Ränge besonders bestechlich. (S. 67)
30) Massive Korruption bis hin zu Regierungsspitze führt nicht gleich zur Instabilität des politischen Systems, solange Aufwärtsmobilität über Politik oder Bürokratie möglich bleiben. (S. 67)
31) Mit fortschreitender Modernisierung konzentriert sich die Korruption auf die unteren Ränge der Verwaltungshierarchie. (S. 68) Schließlich ist die Regierungsspitze weitgehend korruptionsfrei. (68)
32) Korruption, die durch die Zunahme staatlicher Regulierung veranlasst ist, kann das wirtschaftliche Wachstum stimulieren. Viele Straßen, Bahnen oder Industrieanlagen würden ohne Korruption überhaupt nicht gebaut. »In terms of economic growth, the only thing worse than a society with a rigid, overcentralised, dishonest bureaucracy is one with a rigid, overcentralised, honest bureaucracy.« (S. 69)
33) Korruption verstärkt oder verfestigt tendenziell eine schwache Staatsbürokratie. (S. 69)
34) Korruption gibt es erst im Zuge der Modernisierung mit dem Wachsen politischem Bewusstsein und politischer Partizipation. Diese Partizipation zu kanalisieren ist die Aufgabe der politischen Parteien. (S. 70f.)
35) In den meisten Ländern, die sich modernisieren, ist die Bürokratie im Vergleich zur Organisation der politischen Interessen, insbesondere in den Parteien, überentwickelt. In diesen Fällen kann es für die Entwicklung des politischen Systems hilfreich sein, wenn die Bürokratie zugunsten der Parteien korrupt ist. Die Begünstigung politischer Parteien ist eine milde Form der Korruption, wenn sie überhaupt diesen Namen verdient. (S. 68)
36) Starke politische Parteien sind entweder durch Revolution oder durch Begünstigung von oben entstanden. In Entwicklungsländern muss der Staat eine größere Rolle bei der Formierung der Parteien übernehmen (Beispiele Türkei, Mexiko, Südkorea). (S. 70)
37) Die Korruption in Westafrika hängt zum Teil mit dem Fehlen politischer Parteien zusammen. (S. 70)
Huntington (1927-2008) war mit seinen vielen prägnanten Aussagen alles andere als ein Langweiler. Aber er gilt, nicht zuletzt wegen seiner These vom Clash of Civilizations, als Konservativer, von dem man sich zu distanzieren hat, nicht selten nach dem Motto, dass nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Und so wird heute auch sein Text zum Verhältnis von Modernisierung und Korruption behandelt. Seine These, dass im Zuge der Modernisierung einer Gesellschaft gewisse Formen von Korruption relativ funktional sein könnten, wird dahin missverstanden, er habe behauptet, Korruption könne schlechthin funktional sein. Und das ist politisch natürlich ebenso inkorrekt, wie die andere Kernaussage, dass Entwicklungsländer unvermeidlich korruptionsanfällig seien. Die Unvermeidbarkeitsthese wird kurzerhand als widerlegt abgefertigt. Die Belege, die dazu herangezogen werden, ergeben, liest man dort nach, eher das Gegenteil. Es handelt sich um Montinola/Jackmann und Simcha 1983 . Simcha setzt sich nicht wirklich mit dieser These auseinander, sondern stellt darauf ab, dass in allen Ländern Korruption an der Tagesordnung sei. Das hatte Huntington nicht in Abrede gestellt. Zu dem unterschiedlichen Niveau von Korruption in verschiedenen Ländern macht Simcha keine Aussage. Montinola/Jackmann befassen sich an der angegebenen Stelle nur mit der Funktionalitätsthese, die sie keineswegs ganz verwerfen. Ihr empirischer Beitrag besteht unter anderem in dem Nachweis, dass die Korruption mit der Zunahme des Bruttosozialprodukts je Einwohner zurückgeht. Das ist viel eher eine Bestätigung der Unvermeidbarkeitsthese.
Viele der Einzelhypothesen sind längst – mit oder ohne Bezug auf Huntington – Gegenstand empirischer Prüfung gewesen.
Ähnliche Themen