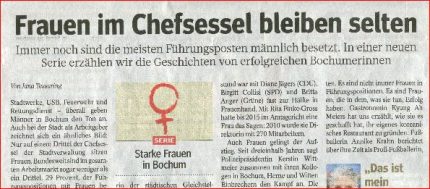Was man mit der Statistik alles anrichten kann: Am 18. März war Equal Pay Day. Für den 10. Dezember hat das Forum für Männerrechte vor bald drei Jahren den Equal Life Day ausgerufen, freilich ohne großes Echo.[1] Aber die Rechnung stimmt. Die Lebenserwartung von Männern liegt nach den jüngsten vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung veröffentlichten Daten bei 78,31, die von Frauen bei 85,20 Jahren. Frauen leben also fast fünf Jahre länger als Männer. Der Gender Life Gap hat sich zwar laufend verringert. Mit zunehmendem Alter reduziert sich zunächst die fernere Lebenserwartung. Bei 65-Jährigen beträgt sie 3,22 Jahre. Noch ist nicht zu erkennen, ob und wann jemals ein Gleichstand erreicht sein könnte. Rechnet man die Lebenserwartung in Prozente um, so werden aus der Differenz von 4,91 Jahren 5,8 %. Bezogen auf die männliche Lebenserwartung wären es 6,3 %. Mit Frauen verglichen ist jedes Lebensjahr für Männer um 21 Tage kürzer. Aus Männersicht ist die Lebenserwartung der Frauen um 22 Tage höher. Daher der 10. Dezember als Equal Life Day. So kann man mit Zahlen jonglieren, die höchst interpretationsbedürftig sind.
Zieht man eine neue Untersuchung der Bertelsmann Stiftung zur Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt[2] zu Rate, so sind Frauen die Gewinner auf dem Arbeitsmarkt. Politiker dürfen über den immer noch verbleibenden Abstand jammern. Wissenschaftler, die in die Klage einstimmen, haben ihre Lektion nicht gelernt, in diesem Falle das Gesetz von der Pfadabhängigkeit der sozialen Entwicklung. Martin Schröder hat kürzlich auf die Schwarzmalerei als déformation professionelle der Soziologen hingewiesen und als Beispiel den Gender Pay Gap genannt:
»Geschlechterungleichheit ist mittlerweile eines der großen soziologischen Themen. Doch wer reflektiert, warum heute ein (unbereinigter) Gender Pay Gap von etwas über 20 % ein enormes Forschungsfeld motiviert, während derselbe Gender Pay Gap noch Mitte der 1950er Jahre bei circa 80% und selbst 1990 bei circa 40% lag, ohne entsprechende Debatten auszulösen?«
Die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung belässt es für die Interpretation der Zahlen nicht bei der individuellen Perspektive einzelner Frauen, sondern stellt auf den Haushaltskontext ab, das heißt also, auf die Familienverhältnisse. Da zeigt sich, dass alleinerziehende Mütter die größte Problemgruppe sind. Man darf wohl fragen, warum die Mütter ihre Kinder nicht häufiger den Vätern überlassen. Dass die Väter sie nicht wollen, ist keineswegs immer der Grund. Irgendwie scheint es doch eine besondere Affinität der Mütter zu ihren Kindern zu geben. Das war die Auffassung des Gesetzgebers hinter § 1626a II BGB a. F., die der EGMR aus Rechtsgründen nicht hat gelten lassen[3], die aber damit als Faktum nicht aus der Welt ist. Wer diese Auffassung nicht teilt, muss fragen, wieweit der Status der alleinerziehenden Mutter ein selbstgewählter ist mit der Folge, dass er keine besondere Unterstützung verdient.
In der Ehe und wohl auch in anderen Dauerpartnerschaften mit Kindern ist das Erwerbseinkommen der Männer höher. Solange die Partnerschaft funktioniert, haben die Frauen an dem Einkommen ihrer Männer Anteil. Bei einer Auflösung der Ehe schafft die Aufteilung des Zugewinns einschließlich der Versorgungsansprüche einen Ausgleich. Das kann man nur beklagen, wenn man das damit verbundene Familienbild ablehnt. Elisabeth Badinter hat vollkommen recht, wenn sie meint, die Mutterrolle nehme höchstens 15 Jahre des Lebens ein; es sei kurzsichtig, das gesamte Lebensschicksal darauf auszurichten.[4] Sie schließt ihren Essay mit dem Satz:
»Ich sage nicht, dass Nicht-Stillen ein Sieg für die Frauen ist. Was in meinen Augen zählt, ist die Entscheidungsfreiheit.«
Genau diese Freiheit wird jedoch unterlaufen, wenn equal pay das Ziel ist. Damit verbindet sich ein Druck, der das viel diskutierte Nudging als Kinderspiel erscheinen lässt. Überragendes Ziel sollte es dagegen sein, dass Frauen während der Zeit, in der sie die Mutterrolle wahrnehmen wollen, ihre Berufsqualifikation bewahren und den Anschluss an die Arbeitswelt behalten können. Das ist nicht nur notwendig, weil Ehegatten einander nach der Scheidung nicht mehr unterhaltspflichtig sind. Beruf ist nicht nur Einkommensquelle, sondern auch Lebensinhalt. Deshalb verdient die Möglichkeit, jederzeit voll in den Beruf einzusteigen, Priorität.
Nicht weniger interessant als das Erwerbseinkommen ist die Verteilung des Vermögens zwischen den Geschlechtern. Insoweit fehlen (mir) neuere Zahlen. Ich lege daher die Annahmen der Hans-Böckler-Stiftung von 2010[5] zugrunde. Danach gibt es auch einen deutlichen Wealth Gap. Auch die Vermögensunterschiede werden jedoch erst relevant, wenn sie im Haushaltskontext interpretiert werden. Dann ergibt sich beinahe zwangsläufig, dass der Mann als der formale Breadwinner formal auch Vermögensträger ist. Dann kommt es darauf an, ob und wie die Frauen während der Partnerschaft an dem Vermögen teilhaben und wo es nach dem Ende der Partnerschaft verbleibt. Auch hier gibt es den Ausgleichsmechanismus für Zugewinn und Versorgungsansprüche. Wegen ihrer längeren Lebenserwartung genießen die Frauen das mehr oder weniger gemeinsame Vermögen häufiger als Erben. Ohne genaue Beschreibung der Familienpraxis kommt man hier nicht weiter.[6] Im Gap-Modus formuliert ist das die Frage nach dem Gender Decision Making Gap.[7]
Interessant bleibt vor allem die Frage, ob Frauen in der Arbeitswelt diskriminiert werden. Allgemein wird angenommen, dass viele Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als Männer. Diese Annahme liegt dem Entgelttransparenzgesetz von 2017 zugrunde. Sie ist freilich nicht belegt. Bei Tariflöhnen und Beamtengehältern gibt es keine Unterschiede. Die Statistik besagt nur, dass Frauen bei gleicher formaler Qualifikation noch 7 % weniger verdienen als Männer.[8] Das kann viele Gründe haben, etwa die Wahl des Arbeitgebers, eine Selbstselektion hinsichtlich des Berufsfeldes, fehlende Berufspraxis oder fehlendes Karriereinteresse. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ist vermutlich in erster Linie ein Karriereproblem, das heißt, dass Frauen beim Aufstieg in höher bezahlte Positionen Schwierigkeiten haben. Das ist schlimm genug. Aber auch insoweit sollte man nicht mehr mit pauschalen Zahlen hantieren. Es braucht eine genauere Beschreibung der Mechanismen, die sich als Karriereschwellen erweisen.[9] Wenn Frauen dann einmal ein bestimmtes Level erreicht haben, dann scheint sie nichts mehr zu bremsen.[10]
Letztlich bleibt der entscheidende Grund für den beruflich-wirtschaftlichen Abstand zwischen den Geschlechtern das Familienbild, an dem sich noch immer die Mehrheit der Paare mit Kindern orientiert. Es mutet der Mutter eine stärkere Rolle bei der Kindererziehung zu, die durch Karriereverzicht erkauft wird. Man kann das freilich auch positiv formulieren: Mütter fühlen sich eher zur Kindererziehung berufen und lassen ihren Männern bei der Karriere den Vortritt. Viele Paare scheinen damit glücklich zu sein, ein Glück, dass der Zeitgeist ihnen nicht mehr gönnen will. Der Zeitgeist wird geprägt durch den Feminismus- und LGBT-Diskurs, an dem sich in erster Linie Autoren beteiligen, die als Person aus der heterosexuellen Matrix und damit aus dem traditionellen Familienschema herausfallen.
Nachtrag: In einem Leserbrief an die FAZ vom 18. 3. 2023 beanstandet Dr. Dr. Maren Krohn, in der Berichterstattung werde meist das nicht bereinigte gender pay gap von 18 % erwähnt, der bereinigte Wert von 7 % gehe unter: »Aber selbst dieser Wert basiert auf Rechentricks. Die Berechnung erfolgt nach EU-Vorgaben. Der gesamte öffentliche Dienst geht nicht ein. Hier wird gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt. Kleinbetriebe unter zehn Beschäftigten gehen nicht ein, also kleine Familienbetriebe entfallen. Fischerei, Forst- und Landwirtschaft, also die schlecht bezahlten Männerberufe, entfallen.«
___________________________________________________________________________
[1] Das »Forum« ist inzwischen geschlossen, angeblich weil die Diskussion sich auf andere Kanäle verlagert hat.
[2] Timm Bönke/Astrid Harnack/Miriam Wetter, Wer gewinnt? Wer verliert?, Bertelsmann Stiftung 2019.
[3] Urteil vom 3. 12. 2009 – Zaunegger.
[4] Elisabeth Badinter, Der Konflikt. Die Frau und die Mutter, 2010 [Le conflit, 2010].
[5] Böckler Impuls Ausgabe 16/2010: Vermögen: Frauen fallen weiter zurück.
[6] Eine solche Beschreibung für Doppelverdiener bieten Wolfgang Ludwig-Mayerhofer/Jutta Allmendinger/Andreas Hirseland/Werner Schneider, The Power of Money in Dual-Earner Couples, Acta Sociologica 54, 2011, 367-383.
[7] Vgl. Fernanda Mazzotta/Anna Papaccio/Lavinia Parisi, Household Control and Management Systems and Women Decision Making within the Family in Europe, 2017.
[8] Vgl. die Gesetzesbegründung BT Drucksache 18/11133.
[9] Solche Studien gibt es durchaus in größerer Zahl. Hier nur ein neues Beispiel aus der Wissenschaft: Sophie E. Acton u. a., The Life of P.I. Transitions to Independence in Academia 2019, bioRxiv Preprint.
[10] Lisa A. Hechtmann u. a., NIH Funding Longevity by Gender, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115, 2018, 7943-7948.
Ähnliche Themen