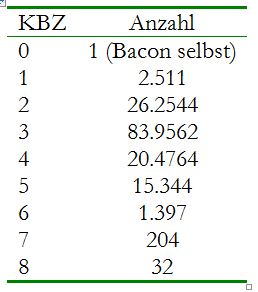Volkswagen Stiftung checkt Juristenausbildung vom 8. Dezember 2012
Inzwischen ist der Tagungsband erschienen: Hagen Hof/Götz von Olenhusen (Hg.), Rechtsgestaltung – Rechtskritik – Konkurrenz von Rechtsordnungen. Neue Akzente für die Juristenausbildung, Baden-Baden, Nomos, 2012 (ISBN 978-3-8329-7362-9)
Hier die Zusammenfassung der Ergebnisse der Tagung aus der Feder von Wilhelm Krull und Hagen Hof.
Was auf der Tagung nicht zur Sprache kam, war die Frage nach der deutschen Juristenausbildung im europäischen Vergleich. Dazu gibt Matthias Kilian in den BRAK-Mittl 2/2012 S. 59-61 die Antwort (Die deutsche Juristenausbildung – wo steht sie im europäischen Vergleich«). Grundlage ist eine 2010 veröffentlichte Studie, in der der Verfasser die Juristenausbildung in 25 europäischen Staaten analysiert Der Bologna-Prozess sei in den anderen Ländern nur »formal implementiert worden, indem traditionelle Ausbildungsgänge in ein Bachelor- und ein Masterstudium gegliedert wurden«. Der wichtigste Unterschied zwischen Deutschland und Resteuropa scheint darin zu bestehen, dass hierzulande der Zugang zum Studium und später auch zum Anwaltsberuf sehr offen ist. Überall sonst wird vor, im und nach dem Studium stärker selektiert. Die post-universitäre Einheitsausbildung (Referendarausbildung) in Deutschland ist europaweit einzigartig. Sie öffnet vor allem den Zugang zum Anwaltsberuf. Diese Offenheit, die anscheinend bisher nicht zu einem Juristenproletariat geführt hat, gilt es zu verteidigen.
Zu Legalisierung von Cannabis II: Steht die zweite Prohibition vor dem Aus? vm 4. April 2012
Nachzutragen ist ein Hinweis auf Gary S. Becker/Kevin M. Murphy/Michael Grossman, The Economic Theory of Illegal Goods: The Case of Drugs, 2004 (NBER Working Paper 10976: http://www.nber.org/papers/w10976). Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass eine Legalisierung weicher Drogen verbunden mit einer hohen Besteuerung wirksamer ist als die strafrechtliche Verfolgung, auch wenn es natürlich Versuche geben werde, die Steuer zu vermeiden. Langsam schwenken auch die Medien auf den Legalisierungskurs ein, so ein großer Artikel von Claudius Seidl und Harald Staun in der FamS vom 29. 4. 2012 (»Machen wir Frieden mit den Drogen«).
Hohfelds analytisches Schema der Rechte (sollte man vergessen) vom 20. September 2011
Neu der (kurze) Artikel von Lawrence B. Solum in seinem »Legal Theory Lexicon«: Hohfeld.
Er gibt keinen Anlass, meine Einschätzung zu ändern.
Was stimmt nicht mit dem Urheberrecht? vom 10. 4. 2012
Manchmal merke ich selbst nicht gleich, wie nahe die Dinge beieinander liegen. Die Blogsoftware von WordPress verweist automatisch am Ende eines Eintrags auf »ähnliche Artikel«. Das System, nachdem diese Verweisungen funktionieren, ist mir nicht klar. So hätte bei diesem Eintrag eigentlich auch auf Rechtssoziologisches zum Urheberrecht? verwiesen werden müssen. Verwiesen wird immerhin auf den Eintrag vom 12. Mai 2011 Das Urheberrecht ist nicht komisch: Bound by Law. Dabei ist mir selbst eine wichtige Verknüpfung zunächst nicht aufgefallen. In jenem Eintrag ging es eigentlich um Keith Aoki. Aber als sein Mitautor wurde auch James Boyle genannt.
James Boyle ist ein wichtiger Theoretiker und Praktiker der kulturellen Allmende. Bisher hatte ich ihn nur als Praktiker zur Kenntnis genommen und als solchen in dem Eintrag über Keith Aoki erwähnt. Erwähnung verdient er aber auch als Theoretiker der Urheberrechtsdebatte. Er prägte er den Begriff des Second Enclosure Movement Gemeint war die schleichende Ausweitung der Immaterialgüterrechte, sei es der Patentrechte auf das menschliche Genom, auf Naturstoffe, biologische Prozesse und traditionelle Rezepte, sei des Urheberrechts durch Ausweitung des Umfangs und Ausdehnung auf Ideen, Software und Daten. »Second« Enclosure deshalb, weil Boyle diese Ausweitung des geistigen Eigentums mit Auflösung der Allemenden im 18. und 19. Jahrhundert und ihrer Überführung in Privateigentum (enclosure of the commons) verglich.
Der späte Start der harten Netzwerkforschung vom 6. Mai 2012
Aus einer Pressemitteilung vom 21. 5. 2012 erfährt man aus der Universität des Saarlandes, dass sich die Informationen in sozialen Netzwerken noch schneller verbreiten, als in Netzwerken, in denen jeder mit jedem kommuniziert, oder deren Struktur völlig zufällig gewachsen ist.« Der Grund dafür, heißt es, »sei das Zusammenspiel zwischen sehr gut und gering vernetzten Personen. »Eine gering vernetzte Person hat natürlich viel schneller ihre wenigen Kontakte informiert«, so Friedrich. Es sei jedoch auch nachweisbar, dass sich unter solchen Kontakten immer sehr gut vernetzte Personen befinden, die wiederum von sehr vielen Personen angefragt würden. Auf diese Weise werde in rasender Geschwindigkeit jeder über die Neuigkeit informiert, so Friedrich. Um das Beziehungsgeflecht in einem realen sozialen Netzwerk zu abstrahieren, nutzten die Forscher sogenannte ›Preferential Attachment Graphs‹ als Netzwerk-Modell. Es beruht auf der Annahme, dass sich neue Mitglieder eher mit bereits bekannten Personen vernetzten als mit unbekannten.« So schrecklich neu klingt das nicht.
Begriffssoziologie V: Konstitutionalisierung strukturell vom 3. März 2011
Gunther Teubner lässt nicht locker, wenn es um seine Idee einer staatsunabhängigen Konstitutionalisierung geht. In der Reihe »Suhrkamp Wissenschaft« ist soeben der Band »Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung« erschienen. Auf einer Tagung in Montcalieri bei Turin hat er seine Idee diskutieren lassen. Darüber berichtet Maximilian Steinbeis in der heimlichen Juristenzeitung vom 23. Mai 2012 S. N4 unter der Überschrift »Occupy the Law!«.
Zur interdisziplinären Verwendung der Netzwerkforschung IV: Und wo bleibt Ostroms Frage? vom 10. Juni 2012
Elinor Ostrom ist am 12. Juni 2012 gestorben. An Stelle eines Nchrufs hier der Link auf den Vortrag über »Coevolving Relationships between Political Science and Economics«, den sie im Novbember 2011 in Bielefeld gehalten hat.
Ähnliche Themen