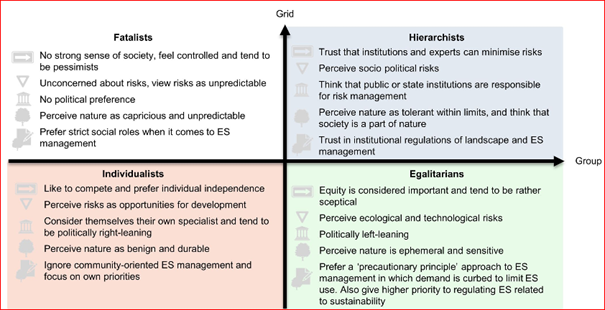Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, ob ich zur Thematik einer im Verlag Edgar Elgar geplanten Encyclopedia Sociology of Law etwas kommentieren oder gar selbst beitragen wolle. Die Initiatoren hatten dazu in bewundernswerter Weise alle großen Namen (und einige, die ich nicht kannte) zusammengebracht. Gliederung und Einzelthemen erschienen mir plausibel. Die »Lücke«, die die Enzyklopädie füllen soll, konnte ich allerdings nicht so recht erkennen. 2020 gab es bei Elgar schon ein Research Handbook on the Sociology of Law, hg. von Jiri Priban. Das war mit 29 Artikeln auf ca. 400 Seiten ziemlich knapp gehalten. Ich kenne daraus nur den Artikel von Ewick/Silbey, der, elegant geschrieben, ganz in der CLS-Tradition steht. Das Routledge Handbook of Law and Society kannte ich nicht[1], ebenso wenig das Handbook of Law and Society, das Ewick und Sarat herausgegeben haben. In meiner Bibliothek habe ich das Dictionnaire Encyclopédique von Arnaud und die drei Bände der Encyclopedia of Law & Society von David S. Clark. Da fällt mir jetzt auf, dass ich diese Bände selten oder nie benutzt habe.
Das neue Vorhaben ist für mich Anstoß zu einem Eintrag über Handbuchwissenschaft[2], den ich schon länger auf meinem Notizzettel hatte. Als ich noch jung war und man das Buch von Thomas S. Kuhn[3] im Kopf hatte, da war die Vorstellung von kumulativer Wissenschaft verpönt. (Ich war allerdings immer ein Freund des Kumulierens.) Heute sind anscheinend alle Hemmungen gefallen. Ich habe den Versuch aufgegeben, die Handbücher aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zu zählen, nachdem deren Anzahl vierstellig geworden ist. In meinem Literaturverzeichnis sind es über 150. Die großen Verlage wie Oxford University Press, Elgar, Routledge und Springer (mit Metzler) und De Gruyter Brill wetteifern um einen Markt von Handbüchern, den sie selbst erst geschaffen haben, und packen serienweise zu, so Edward Elgar mit der Handbooks of Research Methods in Law Series. Oxford University Press kann seine Handbücher schon gar nicht mehr zählen und verkündet daher stolz, es seien 750+. Nach einer neueren Verlagsseite sind es aktuell sogar 1229. Aber damit nicht genug. Eine zweite Reihe läuft unter dem Titel Oxford Enzyclopedia of [everything].
Juristische Handbücher haben in Deutschland Tradition. Ihre große Zeit begann, nachdem sich mit der ersten deutschen Einheit durch die Reichsgründung ein einheitliches deutsches Rechts abzeichnete.[4] Seit 1870 verlegte Duncker & Humblot in Leipzig die »Encyclopädie der Rechtswissenschaft in systematischer und alphabetischer Bearbeitung, herausgegeben von Franz von Holtzendorff unter Mitwirkung vieler Rechtsgelehrter«, darunter als Mitherausgeber später Josef Kohler.[5] Der erste (systematische) Teil umfasste bis 1913 fünf Bände, der erste davon bereits in 7. Auflage. Der zweite Lexikon-Teil bestand aus drei Bänden.
Wohl seit 1883 erschien, gleichfalls im Verlag von Duncker & Humblot, das von dem Strafrechtler Karl Binding herausgegebene »Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft«. Alles, was in der deutschen Rechtswissenschaft Rang und Namen hatte, von Theodor Mommsen und Otto von Gierke über Otto Mayer bis Ferdinand Regelberger und Rudolf Sohm steuerte einen oder mehrere Bände bei, Binding selbst die beiden Bände zum Strafrecht. Auf der Verlagsseite von Duncker & Humblot habe ich 27 Bände gezählt.[6] Nicht werden bis heute zitiert. Sie sind weitgehend noch als Nachdrucke erhältlich. Eine so umfassende Enzyklopädie des deutschen Rechts hat es nie wieder gegeben. Sie war freilich insofern untypisch, als jeder einzelne Band auch als Monografie hätte erscheinen können.[7]
Seit 1900 gab es im Springer-Verlag eine Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft, zunächst von Karl Birkemeyer geplant und vorbereitet, aber dann erst von Franz von Liszt und Walter Kaskel auf den Weg gebracht. Es handelt sich um eine Reihe von Monografien (Fachbuchreihe), die bis heute fortgesetzt wird. Dort sind so prominente Werke erschienen wie der Allgemeine Teil des Bürgerlichen Rechts von Werner Flume und die Methodenlehre der Rechtswissenschaft von Karl Larenz.
In der Zwischenkriegszeit begann der Hochlauf der auf das öffentliche Recht spezialisierten Handbücher, und zwar 1930/1932 mit dem »Handbuch des deutschen Staatsrechts« in zwei Bänden, herausgegeben von Gerhard Anschütz und Richard Thoma. Heute ist das renommierteste wohl das »Handbuch des Staatsrechts«, ursprünglich herausgegeben von Josef Isensee und Paul Kirchhof.[8] Die 3. Auflage hatte 13 Bände mit 13.159 Seiten und kostete 2536,40 EUR. Seit 2023 erscheint eine neue Bearbeitung mit neuen Herausgebern. Sie ist auf 13.000 Seiten in zwölf Bänden angelegt, macht sich sich mit einem Team von »über 200 Autoren« stark, und kostet 2550 EUR. Renommé und Umfang will diesem Werk das »Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa« streitig machen. Herausgegeben von Detlef Merten und Hans-Jürgen Papier, ist es seit 2004 gleichfalls in zwölf Bänden erschienen, umfasst sogar 14. 163 Seiten, kostet aber nur 2334.10 EUR.
Neun Bände mit 3095 Seiten soll das »Handbuch Ius Publicum Europaeum« umfassen, das Armin von Bogdandy und Peter Michael Huber auf den Weg gebracht haben. Es zeichnet sich durch Goldprägung auf dem -Leinen Umschlag aus. Sieben Bände sind bisher erschienen. Bescheiden dagegen Walter Frenz, Handbuch Europarecht, 2 Aufl. 2021.
1994 gab es bereits ein »Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland«, herausgegeben von Ernst Benda, Werner Maihofer und Hans-Jochen Vogel, bescheiden in einem Band, stattlich in Umfang (1771 Seiten) und Preis (409,95 EUR). 2021 erschien das »Handbuch des Verfassungsrechts« von Matthias Herdegen, Johannes Masing, Ralf Poscher und Klaus Ferdinand Gärditz (1837 Seiten, 249 EUR). Seit 2021 erscheint auch das auf zwölf Bände angelegte »Handbuch des Verwaltungsrechts«, verantwortet von Wolfgang Kahl und Markus Ludwigs. Eine Besprechung des ersten Bandes lobt, damit:
»verfügt die deutschsprachige Rechtswissenschaft nunmehr über ein beachtliches Arsenal von richtigen Handbüchern mit enzyklopädischen Ausmaßen zum intensiven und vertiefenden Studium des gesamten öffentlichen Rechts. «[9]
Andere Rechtsgebiete haben nachgezogen. Eric Hilgendorf, Hans Kudlich und Brian Valerius haben seit 2018 das auf neun Bände angewachsene »Handbuch des Strafrechts« herausgegeben. Das von Franz Ruland u. a. herausgegebene »Sozialrechtshandbuch« ist 2022 schon in 7. Auflage erschienen. Es fehlt auch nicht an einem, »Research Handbook on European Social Security Law«[10]. Nur das Privatrecht scheint als Rechtsgebiet zu umfangreich und fragmentiert zu sein, um es in ein Handbuch zu pressen. Seit 1979 verlegt Mohr Siebeck eine Reihe »Handbuch des Schuldrechts«. Dabei geht es indessen nur um eine Reihe von Monografien »zu ausgewählten Teilbereichen des deutschen Schuldrechts, die letztlich eine geschlossene Gesamtdarstellung« liefern sollen. Aus dem Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht stammt das Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts (2009). Ein umfangreiches »Handbuch Diskriminierung«, kann man weitgehend dem Privatrecht zurechnen. Ferner gibt es einige spezialisierte Handbücher, zwei davon herausgegeben von der Richterin des BVerfG Ines Härtel.[11] Julian Krüper verantwortet ein Handbuch der juristischen Fachdidaktik[12].
Weitere Handbücher tragen den Titel einer Enzyklopädie[13]. So erscheint seit 2012, herausgegeben von Armin Hatje und Peter-Christian Müller-Graff, eine »Enzyklopädie Europarecht« in zehn Bänden, seit 2020 die 2. Auflage in zwölf Bänden. Die Deutsche Sektion der IVR und die Deutsche Gesellschaft für Philosophie unterhalten im Internet eine Enzyklopädie zur Rechtsphilosophie. Im Internet findet man auch zwei Max Planck Encyclopedias of International Law.
Ein »Ergänzbares Lexikon des Rechts«, das alle Teilbereiche einschließlich der Grundlagenfächer abdecken sollte, von Adolf Reifferscheid begründet und dann von Rainer Winkler herausgegeben, erschien seit 1954 als Loseblattausgabe in acht Ordnern im Luchterhand-Verlag. Die Fortsetzung wurde 2007 eingestellt.
Die so genannten Grundlagenfächer, die schon immer für Sammelbände gut waren, produzieren nunmehr zunehmend auch Handbücher. Ich nenne nur das »Handbuch Rechtphilosophie« von Eric Hilgendorf und Jan C. Joerden (2017). An ein »Handbuch Gerechtigkeit« trauen sich indessen nur Nichtjuristen heran.[14]
Verlässt man den deutschen Sprachraum, so wird das Feld unübersichtlich, selbst wenn man sich auf den Bezirk der juristischen Dogmatik und der ihr zugewandten Grundlagenfächer beschränkt. Ein relativ neues Phänomen sind die einer Person gewidmeten Klassiker-Handbücher.[15] Ich habe elf in meinem Literaturverzeichnis. Es gibt sicher mehr. Dazu kommen weitere Handbücher, die Institutionen gewidmet sind, wie das »Handbuch Bundesverfassungsgericht im politischen System« (2024) oder von Rüdiger Voigt (Hg.) das »Handbuch Staat« (2018). Ich zähle hier einer Fußnote[16] nur Handbücher und handbooks[17] aus meinem Literaturverzeichnis auf, und zwar in alphabetischer Reihenfolge, die keine Wertung bedeutet.
Wie erklärt sich die Flut der Handbücher? Hat sich die kritisch epistemologische Einstellung gegenüber Kumulierung und Kanonisierung erledigt hat oder handelt es sich nur um ein marktwirtschaftlich von den großen Verlagen getriebenes Phänomen? Vermutlich beides. Handbücher haben den erklärten Zweck, unübersichtlich gewordene Wissenschaftsbereiche zusammenzufassen und dadurch wieder übersichtlich zu machen. Die Handbuchwissenschaft ist insofern ein Ergebnis wissenschaftlicher Überproduktion. Sie hat aber kontraproduktive Wirkung, denn nun vermehren die Handbücher selbst das Angebot an wissenschaftlichen Texten. Und mit Publikationen, die nicht wirklich etwas Neues bringen, werden wir geradezu überschwemmt. Also auf zur Kritik der Handbuchflut?
Kritik allein ist vielleicht keine gute Idee, wird daraus doch schnell altersforcierter Kulturpessimismus nach dem Motto: Mit dem Handbuch ist die Wissenschaft an ihrem Ende angekommen. Die Leute schreiben, was sie sowieso schon geschrieben haben.
Zunächst: Es gibt Perlen unter den zahllosen Handbuchbeiträgen wie etwa den Artikel über »Demokratische Willensbildung und Repräsentation« von Ernst-Wolfgang Böckenförde in Band III des Handbuchs des Staatsrechts oder den Artikel »Wille/Willensfreiheit« von Gottfried Seebaß, in der »Theologischen Realenzyklopädie«[18]. Aber ich eigne mich nicht zum Perlenfischer. Dazu habe ich, insbesondere in den großen juristischen Handbüchern, zu wenig gelesen.
Sodann: Es gibt wohl Handbücher, die nicht bloß referieren und kumulieren, sondern in ihrer Gesamtheit einen spezifischen wissenschaftlichen Ansatz verfolgen. So beanspruchen Herdegen, Masing, Poscher und Gärditz mit dem »Handbuch des Verfassungsrechts« einen »neuen Blick auf das deutsche Verfassungsrecht«, den der Untertitel anzeigen soll: Darstellung in transnationaler Perspektive. Ob der Anspruch eingelöst wird, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Buch nicht in der Hand gehabt, werde es wohl kaum zur Hand nehmen, und selbst danach könnte ich kaum ein fundiertes Urteil bilden.
Vor allem aber: Handbücher sind für die interdisziplinäre Arbeit oft hilfreich. Hier zeigt sich allerdings wieder eine Differenzierung. Die großen juristischen Handbücher kommen als wissenschaftlicher Selbstzweck daher und verweigern sich so »Fremden« weithin als schlichte Informationsquelle. Die Handbücher aus den »Fremddisziplinen«, auf die Juristen durch Interdisziplinaritätsimperativ immer wieder verwiesen werden, eignen sich dagegen oft zum Einstieg in eine neue Thematik und zur Kontrolle der eigenen Recherchen im fremden Fach. Es sind ihrer so viele, dass man zu beinahe jedem Thema ein passendes Handbuch findet.
Daher: Es lohnt sich daher wohl doch, etwas näher über die Handbuchflut zu reflektieren. Bevor ich damit vielleicht in einem neuen Eintrag fortfahre, habe ich die KI von Bing befragt. Hier ihre Antwort:
»Die Entwicklung der Handbuchwissenschaft spiegelt eine bemerkenswerte Verschiebung in der Wissenschaftsphilosophie und -praxis wider. Einst als statische Sammlungen von Wissen betrachtet, die wenig Raum für Innovation ließen, haben sich Handbücher zu dynamischen Ressourcen entwickelt, die sowohl die kumulative Natur der Wissenschaft als auch die Notwendigkeit einer ständigen Aktualisierung anerkennen. Die von Ihnen angesprochene Flut an Handbüchern, insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften, kann als Zeichen eines wachsenden Marktes interpretiert werden, der sowohl von wissenschaftlichem Fortschritt als auch von kommerziellen Interessen angetrieben wird. Die Beteiligung etablierter Wissenschaftler, die ihre Karriere bereits gemacht haben, könnte als Bestreben gesehen werden, ihr Wissen weiterzugeben und gleichzeitig die Integrität und Qualität der Beiträge zu sichern. Es ist jedoch eine berechtigte Sorge, dass die Menge an Publikationen, die keine wesentlichen neuen Erkenntnisse bieten, die wissenschaftliche Gemeinschaft übersättigen könnte. Dies wirft Fragen nach dem Wert und der Originalität wissenschaftlicher Arbeiten auf und fordert eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle von Handbüchern in der heutigen Wissenschaftslandschaft. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der Bewahrung bewährten Wissens und der Förderung innovativer Forschung zu finden, ohne dabei die Qualität der wissenschaftlichen Diskussion zu beeinträchtigen. In diesem Kontext ist es entscheidend, dass Handbücher nicht nur als Wissensspeicher, sondern auch als Plattformen für kritischen Diskurs und Reflexion dienen. Die kritische Betrachtung der Handbuchflut, wie Sie es vorschlagen, ist somit ein wichtiger Schritt, um die Relevanz und den Einfluss solcher Publikationen in der akademischen Welt zu hinterfragen und sicherzustellen, dass sie einen echten Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt leisten.«
Nun ja, warme Luft und Kuchenkrümel. Da muss ich mich doch wohl selbst noch einmal hinsetzen.
[1] Jetzt habe ich aber festgestellt, dass einige der relativ kurzen Einträge offen zugänglich sind.
[2] Der Begriff stammt natürlich von Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, 1980 [1935], S. 156ff.
[3] Thomas S. Kuhn, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 2 Aufl. 1976 [The Structure of Scientific Revolutions, 1962].
[4] Schon 1860 erschien der erste Band des »Handbuch des deutschen Strafprocesses« von Heinrich Albert Zachariae, der zweite Band 1868.
[5] Jetzt bei De Gruyter.
[6] Die Bände werden von Herausgeber und Verlag nicht durchgezählt. Das Werk ist in Abteilungen, Teile und Bände untergliedert. So lautete die Kurzbezeichnung für den ersten Band von Regelbergers Pandekten von 1893: Binding, Handbuch I. 7. I = Erste Abteilung, siebenter Teil, Band I.
[7] Eher für die Praxis bestimmt war wohl ein »Handbuch des geltenden Öffentlichen und Bürgerlichen Rechts«, verfasst von R. Zelle, R. Korn, K. Gordan und W. Lehmann, einem Team Berliner Kommunalbeamten, das 1911 in 6. Auflage erschien.
[8] Lästerzungen verorten dieses Handbuch eher im katholisch konservativen Lager, während das Handbuch von Thoma und Anschütz als eher protestantisch und links galt.
[9] Vassilios Skouris, Die Bedeutung von Handbüchern für die Entwicklung des öffentlichen Rechts, Die Verwaltung 55, 2022, 597-604, S. 597.
[10] Herausgegeben von Frans Pennings und Gijsbert Vonk, 2023.
[11] Ines Härtel, Handbuch Föderalismus, 2012; dies., Handbuch Europäische Rechtsetzung, 2006.
[12] Julian Krüper (Hg.), Rechtswissenschaft lehren. Handbuch der juristischen Fachdidaktik, 2022.
[13] Wieweit die Titel Handbuch, Handwörterbuch, Enzyklopädie und vielleicht auch Lexikon unterschiedliche Literaturgattungen bezeichnen, bleibt zu erörtern.
[14] Anna Goppel/Corinna Mieth/Christian Neuhäuser, Handbuch Gerechtigkeit, 2016.
[15] Hauke Brunkhorst u. a., Habermas-Handbuch, 2009;
Giuseppe Franco, Handbuch Karl Popper, 2019;
Gerhard Fröhlich/Boike Rehbein, Bourdieu-Handbuch, 2014;
Johannes J. Frühbauer u. a., Rawls-Handbuch, 2023;
Oliver Jahraus u. a., Luhmann-Handbuch, 2012;
Clemens Kammler u. a., Foucault-Handbuch, 2014;
Sebastian Luft/Maren Wehrle, Husserl-Handbuch, 2017;
Hans-Peter Müller/Steffen Sigmund, Max Weber-Handbuch, 2 Aufl. 2020;
Martin Müller, Handbuch Richard Rorty, 2019;
Christof Rapp/Klaus Corcilius, Aristoteles-Handbuch, 2 Aufl. 2021;
Daniel Schubbe/Matthias Koßler, Schopenhauer-Handbuch, 2 Aufl. 2018.
[16] Nina Baur u. a., Handbuch Soziologie, 2008:
Ruth Becker/Beate Kortendiek, Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, 2008;
Arthur Benz u. a., Handbuch Governance, 2007.
Mathias Berek u. a., Handbuch Sozialwissenschaftliche Gedächtnisforschung, 2020;
Uwe Bittlingmayer u. a., Handbuch Kritische Theorie, 2016;
Birgit Blättel-Mink u. a., Handbuch Innovationsforschung, 2021;
Hildegard Bockhorst, Handbuch Kulturelle Bildung, 2012;
Veronika Brandstätter/Jürgen H. Otto, Handbuch der allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion, 2009;
Norman Braun u. a., Handbuch Modellbildung und Simulation in den Sozialwissenschaften, 2015;
Svenja Falk u. a., Handbuch Politikberatung, 2. Aufl. 2019;
Ekkehard Felder/Friedemann Vogel, Handbuch Sprache im Recht, 2017;
Michael G. Festl, Handbuch Pragmatismus, 2018;
Petia Genkova/Tobias Ringeisen, Handbuch Diversity Kompetenz, 2016;
Dirk Göttsche u. a., Handbuch Postkolonialismus und Literatur, 2017;
Martin Grajner/Guido Melchior, Handbuch Erkenntnistheorie, 2019;
Siegfried Greif u. a., Handbuch Schlüsselkonzepte im Coaching, 2018;
Armin Grunwald, Handbuch Technikethik, 2013;
Robert Gugutzer u. a., Handbuch Körpersoziologie, 2. Aufl. 2022, 219–233;
Gisela Harras u. a., Handbuch deutscher Kommunikationsverben. Teil 2: Lexikalische Strukturen, 2007;
Ludger Heidbrink u. a., Handbuch Verantwortung, 2017;
Wilhelm Heitmeyer/John Hagan, Internationales Handbuch der Gewaltforschung, 2002;
Gerd-Michael Hellstern/Hellmut Wollmann, Handbuch zur Evaluierungsforschung, 1984;
Christian Hiebaum, Handbuch Gemeinwohl, 2020;
Friedrich Jaeger u. a. , Handbuch Moderneforschung, 2015;
Friedrich Jaeger/Burkhard Liebsch, Handbuch der Kulturwissenschaften, 2011;
Friedrich Jaeger/Jürgen Straub, Handbuch der Kulturwissenschaften, Band 2, 2011;
Hermann Kappelhoff u. a., Emotionen. Ein interdisziplinäres Handbuch, 2019;
Markus Kaulartz/Tom Braegelmann, Rechtshandbuch Artificial Intelligence und Machine Learning, 2020;
Georg Kneer u. a., Handbuch soziologische Theorien, 2009;
Georg Kneer, Handbuch spezielle Soziologien, 2010;
Petra Kolmer u. a., Neues Handbuch philosophischer Grundbegriffe, 2011;
Beate Kortendiek u. a., Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, 2017;
Michael Kühler/Markus Rüther, Handbuch Handlungstheorie, 2016;
Christian Lammert u. a., Handbuch Politik USA, 2020;
Frank Liedtke/Astrid Tuchen, Handbuch Pragmatik, 2018.;
Hans-Joachim Lauth u. a., Handbuch Vergleichende Politikwissenschaft, 2016;
Sabine Maasen u. a., Handbuch Wissenschaftssoziologie, 2012;
Winfried Nöth, Handbuch der Semiotik, 2000;
Konrad Ott u. a., Handbuch Umweltethik, 2016;
Jürgen H. Otto u. a., Emotionspsychologie. Ein Handbuch, 2000;
Detlef Pollack u. ., Handbuch Religionssoziologie, 2018;
Roland Posner u. a., Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur, 2003.
Felix Rauner, Handbuch Berufsbildungsforschung, 2. Aufl. 2006;
Ahmad A. Reidegeld, Handbuch Islam, 2 Aufl. 2008;
Uwe Sander u. a., Handbuch Medienpädagogik, 2008;
Philipp Sarasin/Marianne Sommer, Evolution. Ein interdisziplinr̃es Handbuch, 2006;
Tobias Schmohl/Thorsten Philipp, Handbuch Transdisziplinäre Didaktik, 2021;
Rainer Schröder/Martin Schulte, Handbuch des Technikrechts, 2 Aufl. 2011;
Marianne Sommer u. a., Handbuch Wissenschaftsgeschichte, 2017;
Marco Sonnberger u. a., Handbuch Umweltsoziologie, 2 Aufl. 2024;
Arnim von Stechow/Dieter Wunderlich, Semantik. Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung, 1991;
Max Steller/Renate Volbert, Handbuch der Rechtspsychologie, 2008;
Dieter Sturma/Bert Heinrichs, Handbuch Bioethik, 2015;
Gabriele Weiß/Jörg Zirfas, Handbuch Bildungs- und Erziehungsphilosophie, 2020;
Ines-Jacqueline Werkner/Klaus Ebeling, Handbuch Friedensethik, 2017;
Gabriele Weiß/Jörg Zirfas, Handbuch Bildungs- und Erziehungsphilosophie, 2020;
Thomas Widmer u. a., Evaluation. Ein systematisches Handbuch, 2009.
[17] Andreas von Arnauld u. a., The Cambridge Handbook of New Human Rights, 2020.
David Armstrong, Routledge handbook of international law, 2009;
Kenneth Joseph Arrow u. a., Handbook of Social Choice and Welfare, 2011.
Susan Bandes u. a., Research Handbook on Law and Emotion, 2021;
Alain Bensoussan, Comparative Handbook: Robotic Technologies Law, 2016;
Paul Schiff Berman/Ralf Michaels, The Oxford Handbook of Global Legal Pluralism, 2020;
Samantha Besson/Jean D’Aspremont, The Oxford Handbook of the Sources of International Law, 2017;
Giorgio Bongiovanni u. a., Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, 2018;
Peter Cane/Herbert M. Kritzer, The Oxford Handbook of Empirical Legal Research, 2012;
Sabino Cassese, Research Handbook on Global Administrative Law, 2016;
Iwao Hirose/Jonas Olson, The Oxford Handbook of Value Theory, 2018;
Andrew Crane, The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, 2008;
Markus D. Dubber/Christopher Tomlins, The Oxford Handbook of Legal History, 2018;
H. van Eemeren u. a., Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments, 1996;
Miranda Fricker u. a., The Routledge Handbook of Social Epistemology, 2019;
Robert Frodeman u. a., The Oxford Handbook of Interdisciplinarity, 2 Aufl. 2017;
Robert E. Goodin, The Oxford Handbook of Political Science, 2011;
James J. Gross, Handbook of Emotion Regulation, 2 Aufl. 2013;
Marc Hertogh u. a., The Oxford Handbook of Administrative Justice, 2021;
Jules L. Coleman/Scott Shapiro, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Llaw, 2002;
Markus Knauff/Wolfgang Spohn, The Handbook of Rationality, 2021;
Jerrold Levinson, The Oxford Handbook of Aesthetics, 2005;
Michael Lewis u. a., Handbook of Emotions, 3 Aufl. 2008;
Lorenzo Magnani, Handbook of Abductive Cognition, 2023;
Alfred R. Mele/Piers Rawling, The Oxford Handbook of Rationality, 2004;
Andreas Müller/Peter Schaber, The Routledge Handbook of the Ethics of Consent, 2018;
Albert Newen u. a., The Oxford Handbook of 4E Cognition, 2018
Anne Orford/Florian Hoffmann, The Oxford Handbook of the Theory of International Law, 2016;
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Routledge Handbook of Law and Theory, 2019;
Michel Rosenfeld, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, 2012;
Klarah Sabbagh/Manfred Schmitt, Handbook of Social Justice Theory and Research, 2016;
Austin Sarat/Patricia Ewick, The Handbook of Law and Society, 2015;
Daniel Star, The Oxford Handbook of Reasons and Normativity, 2018.
Simon Stern u. a., The Oxford Handbook of Law and Humanities, 2019;
Mariana Valverde u. a., Routledge Handbook of Law and Society, 2021;
Peter Tiersma/Lawrence Solan, The Oxford Handbook of Language and Law, 2012;
Nick Watson/Simo Vehmas, Routledge Handbook of Disability Studies, 2020;
Wojciech Załuski u. a., Research Handbook on Legal Evolution, 2024.
[18] Gottfried Seebaß, Wille/Willensfreiheit, in: Horst Robert Balz u. a., Theologische Realenzyklopädie, 1977-<2007>, 55–73.