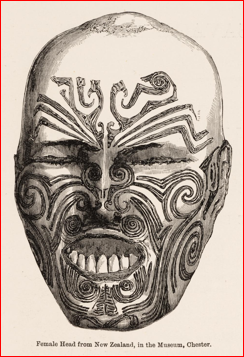Der EU-Haushalt und damit der European Recovery Fund hängen am sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, und Kommissionspräsidentin von der Leyen wird mit dem Satz zitiert: »Deshalb kann es keine Kompromisse geben, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht.« In der FAZ gab es am 2. 12. die hübsche Glosse eines philosophisch gebildeten Politikwissenschaftlers[1] zur Kunst der Politik, etwas zu sagen, ohne etwas Genaues zu sagen, einer rhetorischen Figur, für die er bei Blumenberg die Benennung als »dosierte Ungenauigkeit« gefunden hatte. »Kompromisse« sind ungenau. »Keine Kompromisse« ist genau. Rechtsstaatlichkeit ist ungenau. Der Rechtsstaatsmechanismus ist kein Mechanismus. Die Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Oktober 2020 zu der Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte macht aus Art. 2 EUV mit 45 »Hinweisen«, 15 »Erwägungen« und 17 Warnungen, Begrüßungen usw. ein juristisches Monster. Das kommt, wenn man den Rechtsstaatsbegriff materiell und inklusiv auflädt.
Es ist im wahren Sinne des Wortes pervers, zur Erläuterung des Rechtsstaatsbegriffs von einem Text Carl Schmitts[2] auszugehen, der keinen anderen Zweck hatte, als den Rechtsstaat durch einen nationalsozialistischen Unrechtsstaat abzulösen. Aber Carl Schmitt war mephistophelisch klug. Deshalb ist sein Text geeignet, die Konturen des Rechtsstaats, wie wir ihn heute verstehen, zu schärfen.
»In Wirklichkeit ist gerade der Rechtsstaat Gegenbegriff gegen einen unmittelbar gerechten Staat; es ist ein Staat, der ›feste Normierungen‹ zwischen sich und die unmittelbare Gerechtigkeit des Einzelfalles einfügt. Die allein sinnvollen Gegenbegriffe gegen einen Rechtsstaat sind Staatsarten, die eine andere als diese bloß mittelbare ›normative‹ Beziehung zur Gerechtigkeit haben, also der Religions- oder der Weltanschauungs- oder der Sittlichkeitsstaat.« (S. 190)
Schmitt weist auf die Entstehung des Rechtsstaatsbegriffs seit 1830 hin, der auf die »Forderung einer Unterwerfung des Staates unter die individualistisch-bürgerliche Gesellschaft« hinauslaufe. So sei aus Recht und Gerechtigkeit ein positivistisches Zwangsnormengeflecht geworden, dessen ganze Gerechtigkeit in der Rechtssicherheit bestehe. Das Ideal der Justizförmigkeit aller Staatsakte und der Grundsatz der »Gesetzmäßigkeit« der Verwaltung, ja, der normativistischen Bindung des gesamten staatlichen Lebens« hätten »Recht und Gesetz zum bloßen Fahrplan der bürokratischen Maschine« gemacht. Schmitt zitiert Friedrich Julius Stahl: »Der Rechtsstaat bedeutet überhaupt nicht Ziel und Inhalt eines Staates, sondern nur Art und Charakter, dieselben zu verwirklichen.« So sei aus dem Rechtsstaat ein bloßes Mittel zum Zweck geworden. Dieser formale Rechtsstaatsbegriff habe keinen Inhalt mehr, lasse aber jeden Inhalt zu. Das wäre, als wolle man das Fußballspiel als eine Konkretisierung seiner Regeln deuten. Schmitts Fazit:
»Damit war die Beseitigung jeder sachinhaltlichen Gerechtigkeit vollendet und der Rechtsstaat zum reinen Gesetzesstaat geworden. Während der frühe liberale Rechtsstaat noch eine Weltanschauung hatte und eines politischen Kampfes fähig war, ist die einzige Weltanschauung, der ein solcher positivistischer Gesetzesstaat spezifisch zugehört, ein hilfloser Relativismus, Agnostizismus oder Nihilismus, dem das Recht ein ›ethisches Minimum‹ ist, der an die ›normative Kraft des Faktischen‹ glaubt und dem die unmittelbare Gerechtigkeit des Satzes nullum crimen sine poena einen panischen Schrecken einjagt.« (S. 196)
Legt man Schmitts Analyse zugrunde, dann fehlt dem Rechtsstaat in der Tat etwas. Schmitt erwägt, ob es nicht genüge, »einen nationalsozialistischen Rechtstaat einzurichten«. Er überlegt sogar, ob »das Wort ›Rechtsstaat‹ nicht auch [ähnlich wie Recht und Freiheit zu den] unzerstörbaren Worten der deutschen Rechts- und Volksgeschichte« gehöre. Aber am Ende will er ganz auf den Rechtsstaatsbegriff verzichten, um der »weltanschaulich begründeten Einheit von Recht, Sitte und Sittlichkeit« zu genügen. Der Rechtsstaatsbegriff soll zur »Trophäe eines geistesgeschichtlichen Sieges über den bürgerlichen Individualismus und seine Entstellungen des Rechtsbegriffs« werden.
Um diesem Text gerecht zu werden, muss man zur Kenntnis nehmen, dass schon zuvor aus sozialistischer Sicht Otto Kirchheimer den Rechtsstaat zum »reinen Rechtsmechanismus« erklärt hatte:
»Der Staat lebt vom Recht, aber es ist kein Recht mehr, es ist ein Rechtsmechanismus, und jeder, der die Führung der Staatsgeschäfte zu bekommen glaubt, bekommt statt dessen eine Rechtsmaschinerie in die Hand, die ihn in Anspruch nimmt wie einen Maschinisten seine sechs Hebel, die er zu bedienen hat. Das rechtsstaatliche Element in seiner nach Überwindung des reinen Liberalismus nunmehr angenommenen Gestalt, die spezifische Transponierung der Dinge vom Tatsächlichen ins Rechtsmechanistische ist das wesentliche Merkmal des Staates im Zeitalter des Gleichgewichts der Klassenkräfte.« [3]
Von diesem dunklen Hintergrund hebt sich der Staat des Bonner Grundgesetzes durch zwei wesentliche Eigenschaften ab. Er ist Mittel nicht für beliebige Zwecke, sondern für die Durchsetzung demokratisch bestimmter Politik, und er hat ein festes, wenn man so will, ein sittliches Fundament in den Grund- und Menschenrechten. Die Frage ist allerdings, ob man diese materiellen Grundlagen in den Begriff des Rechtsstaats hineinlesen soll, so dass der Rechtsstaatsbegriff materiell oder inklusiv wird. Das wird überwiegend bejaht, ist allerdings kein Fortschritt.
Nach der Wende von 1989 wurde ein Satz, der der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley zugeschrieben wird, zum geflügelten Wort: »Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat«. Dieser Satz wurde vielfach als Argument gegen einen formalen Rechtsstaatsbegriff verwendet[4], taugt dazu aber nicht. Das Grundgesetz hat Demokratie, Grund- und Menschenrechte als eigenständige Prinzipien und Rechte noch vor und neben dem Rechtsstaat installiert. Wenn Art. 28 I GG von »den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes« spricht, so handelt es sich um zusätzliche Qualifizierungen des Staates überhaupt. Substantivisch formuliert: der Staat ist Demokratie, Republik, Sozialstaat und Rechtsstaat. Die materielle Anreicherung des Rechtsstaatsbegriffs, die alle Qualifizierungen des Staates in Rechtsstaatsbegriff hineinnimmt, hat dessen Verwässerung zur Folge, weil er dogmatisch nicht mehr zu handhaben ist. Soweit das Grundgesetz materielle Rechtsprinzipien statuiert hat, ist ein Rückgriff auf das Rechtsstaatsprinzip nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich. Etwas anderes gilt für die Demokratie, die, jedenfalls als formales Prinzip, über die Gewaltenteilung untrennbar mit dem Rechtsstaat verbunden ist.
Heute wissen wir die von Schmitt geschmähte Rechtsförmlichkeit zu schätzen. Sie sorgt für Transparenz und schützt vor Willkür und Korruption. Sie hat neben Demokratie und Grundrechten einen Eigenwert, dem mit einem formalen Rechtsstaatsbegriff besser gedient ist. Dieser Rechtsstaatsbegriff bietet zwar als solcher noch keine subsumtionsfähige Norm, ist aber als Prinzip konkretisierbar. Er lässt sich so weit operationalisieren, dass er am Ende von den Gerichten angewendet werden kann.
Der formale Rechtsstaatsbegriff wird durch die Formprinzipien des positiven Rechts ausgefüllt, wie sie der amerikanische Rechtsphilosoph Lon L. Fuller ausformuliert hat.[5] Für die Rechtslage unter dem Grundgesetz verlangt das Rechtsstaatsprinzip:
Gewaltenteilung, Art. 20 II GG,
den Vorbehalt des Gesetzes für staatliche Eingriffe in Freiheit und Eigentum,
allgemeine, öffentlich bekannt gemachte, verständliche und verlässliche Gesetze,
Verzicht auf rückwirkende Gesetze,
die Bindung von Verwaltung und Rechtsprechung an Gesetz und Recht,
Gleichheit vor dem Gesetz,
Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte, Art. 19 IV GG,
die Justizgrundrechte des Art. 101, 103 GG.[6]
Grund- und Menschenrechte gehören zum (formalen) Rechtsstaat nur, soweit sie positivrechtlich konkretisiert sind. Das bedeutet beispielhaft etwa: Im Streit um die Verfassungsmäßgkeit von § 1353 I BGB oder um einen einfachgesetzlichen Anspruch auf ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Ehepaare kann man sich nicht auf das Rechtstaatsprinzip berufen, sondern muss unmittelbar für einschlägig gehaltene Grundrechte anführen. Der praktische Unterschied besteht darin, dass der formale Rechtstaatsbegriff deutliche juristische Konsequenzen haben kann, während ein inklusiver Begriff eine gesellschaftliche und politische Diskussion voraussetzt, die nicht in allen Staaten einheitlich verläuft.
Ein prominenter Vertreter des formellen Rechtstaatsbegriffs ist Joseph Raz:
»Not uncommonly when a political ideal captures the imagination of large numbers of people its name becomes a slogan used by supporters of ideals which bear little or no relation to the one it originally designated. The fate of ›democracy‹ not long ago and of ›privacy‹ today are just two examples of this familiar process. In 1959 the International Congress of Jurists meeting in New Delhi gave official blessing to a similar perversion of the doctrine of the rule of law.«[7]
Viele meinen, Raz habe sich selbst widerlegt, wenn er fortfährt (S. 209):
»A non-democratic legal system, based on the denial of human rights, on extensive poverty, on racial segregation, sexual inequalities, and religious persecution may, in principle, conform to the requirements of the rule of law better than any of the legal systems of the more enlightened Western democracies.«
Aber diese Aussage gilt nur, wenn die Gewaltenteilung fehlt, die ohne Demokratie und unabhängige Gerichte nicht zu haben ist. Im Übrigen sollte die Diskussion um das Recht des NS-Staats gezeigt haben, dass dessen Pervertierung bei Einhaltung formal rechtsstaatlicher Regeln nicht möglich gewesen wäre.
Ich begründe den Wert der Form etwas anders als Fuller in der berühmten Debatte mit H. L. A. Hart.[8] Fuller fand in der Form des Rechts dessen innere Moralität. Ich sehe im formalen Rechtsstaat eine arbeitsteilige Organisation zur Herstellung rechtlich bindender Entscheidungen aller Art von Gesetzen bis hinunter zu Urteilen und Verwaltungsakten. Die förmlich festgelegte Arbeitsteilung zwischen Wahlvolk, Parlament, Regierung, Verwaltung und Justiz bietet er eine bessere Gewähr für die strukturelle Rationalität[9] des Rechts als Ethik und Philosophie. Subjektive Rationalität, wie sie der Ausgangspunkt für Max Webers Handlungslehre war, wie sie die Grundlage aller Rational-Choice-Ansätze und der damit verbundenen Entscheidungstheorien bildet, verlangt immer Werturteile über Zwecke und Mittel und deren Verhältnismäßigkeit. Die Suche nach einer rationalen Methode der Konsolidierung subjektiver Urteile war bisher vergeblich. Dafür stehen das Condorcet-Paradox und das Arrow-Theorem. Die rechtsphilosophischen Bemühungen um eine universalistische Ethik sind nur begrenzt hilfreich. Praktisch brauchbar ist nur die Einbindung subjektiver Rationalität in den institutionalisierten Pluralismus des (formalen) Rechtsstaats. Sie ergibt, was Helmut Schelsky juridische Rationalität genannt hat.[10] Über die konkrete Ausgestaltung dieser Organisation kann und muss man wiederum subjektiv rational streiten. Das ist ein Rekursivitätsproblem, wie es in einem nicht fundamentalistisch begründeten Recht unvermeidbar ist. Es löst sich leichter als die unmittelbare Auseinandersetzung über Sachfragen, denn es kann unter dem insoweit hilfreichen »Schleier des Nichtwissens« (Rawls) verhandelt werden. Entsprechend kann man sich im politischen Raum leichter über die Organisation des Rechtsstaats einigen als über materielle Werte, die schnell zum Wunschzettel der unterschiedlichsten Interessengruppen werden.
Die Rechtsstaatlichkeit gehört zu den Werten, auf die sich die EU gründet (Art. 2 EUV).[11] Besteht die »die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Art. 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat«, so besteht nach Art. 7 EUV die Möglichkeit, diesem Staat Rechte aus dem Vertrag zu entziehen. Die Hürden des Art. 7 sind jedoch hoch. Seitens der Kommission ist gegen Polen im Dezember 2017 mit einem Begründeten Vorschlag nach Art. 7 I EUV ein solches Verfahren eingeleitet worden. Das Europaparlament löste dann September 2018 ein solches Verfahren auch gegen Ungarn aus. Der Abschluss der Verfahren setzt jedoch nach Art. 7 II EUV den einstimmigen Beschluss des Rates voraus, der nicht zu erreichen sein wird. Daher hatte die Kommission schon 2014 einen »EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips« aufgestellt.
Auf der Grundlage des Art. 258 AEUV hat die Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich, Ungarn und Polen eingeleitet, um Verletzungen des Rechtsstaatsprinzips zu monieren. Am 5. 11. 2019 entschied der EuGH in einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, dass unterschiedliche Ruhestandsregelungen für Richter gegen Art. 157 AEUV verstoßen, ferner die Zwangspensionierung der Richter im Alter von 65 Jahren gegen Art. 19 Abs. 2 UA 2 EUV (C-192/18). Am 19. 11. 2019 folgte in verbundenen Vorlageverfahren die Feststellung, dass der polnische Oberste Gerichtshof prüfen müsse, ob die Disziplinarkammer insbesondere bei kumulativer Betrachtung bestimmter Gesichtspunkte hinreichende Gewähr für Unabhängigkeit biete (C-585/18, C-624/18 und C-625/18). Am 5. 12. 2019 entschied der polnische Oberste Gerichtshof, dass die Disziplinarkammer den Unabhängigkeitsanforderungen des Unionsrechts nicht entspreche. Am 20. 12 2019 nahm das polnische Parlament ein Gesetz an, mit dem u. a. das Disziplinarregime gegen Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte verschärft wurde. Zudem wurde die Anwendung des EuGH-Urteils vom 19. 11. 2019 unter Strafe gestellt. Das Gesetz trat am 14. Februar 2020 in Kraft. Als Konsequenz hat das OLG Karlsruhe mit Beschluss vom 17. 2. 2020 (Ausl 301 AR 15/19) einen Auslieferungshaftbefehl aufgehoben, weil eine Auslieferung nach Polen mit »hoher Wahrscheinlichkeit« unzulässig sein werde.
Am 26. 3. 2020 wies der EUGH zwei Vorabentscheidungsbegehren polnischer Gerichte, die darauf gestützt waren, dass das neue polnische Disziplinarrecht eine politische Einflussnahme auf richterliche Entscheidungen befürchten lasse, als unzulässig zurück (C‑558/18 und C‑563/18). Die Vorlagefragen bezögen sich nicht unmittelbar auf Vorschriften, deren Auslegung für die Entscheidung der Ausgangsfälle relevant sei. In einem obiter dictum stellte der EUGH dann aber heraus, dass nationale Bestimmungen, nach denen gegen nationale Richter ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden könne, weil sie ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof gerichtet hätten, die richterliche Unabhängigkeit verletzten. Ob das polnische Richterdisziplinarrecht tatsächlich eine solche Möglichkeit eröffnet, bleibt offen.
Die Erfolglosigkeit, mit der Donald Trump versucht, die Gerichte gegen seine Abwahl zu mobilisieren, scheint zu zeigen, dass wissenschaftlich ausgebildete unabhängige Richter sich nicht so einfach steuern lassen. Was genau in Polen passiert ist, damit es zu dem Abtreibungs-Urteil des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 2020 kommen konnte, ist (mir) noch nicht klar. Unklar ist, ob die neue Ruhestandsregelung für Richter, die am 3. Juli 2018 in Kraft trat, auch die Richter des Verfassungsgerichts betrifft. Alle Richter des Verfassungsgerichts sind ordentlich vom Parlament (Sejm) gewählt worden, bis auf einen sämtlich auf Vorschlag der PIS, davon allein sechs seit 2019. Als Ersatz für vorzeitig in den Ruhestand geschickte Vorgänger? Der Anschein spricht in der Tat dafür, dass hier der politische Druck durchschlug. Doch jetzt passiert in Polen genau das, was notwendig ist, nämlich eine breite gesellschaftliche Diskussion, in deren Verlauf die staatstragende PIS-Partei schon erheblich an Zustimmung verloren hat, und an deren Ende vielleicht sogar ein liberaleres Abtreibungsrecht stehen könnte als bisher.
Der Rechtsstaatsbegriff wird in der EU inklusiv verstanden, soll also die Grund- und Menschenrechte einschließen. So werden Pressefreiheit, Asylverfahren oder Rechtsforderungen von LGBT als Rechtsstaatsprobleme verhandelt. Bei dem EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips geht es nicht nur um eine kurze und bündige Benennung des Programms, sondern darum, dem Eingriff in das politische Geschehen innerhalb der Mitgliedsstaaten einen objektiven Anstrich zu geben, wie ihn anscheinend nur der Rechtsstaatsbegriff leisten kann. Die EU greift aus dem Wertekatalog des Art. 2 EUV den Rechtsstaatsbegriff heraus, um dann indirekt andere der dort genannten Werte einzuführen. Mit seiner Hilfe scheint es am ehesten möglich, die Identitätsschranke des Art. 4 II EUV zu überwinden.
Die EU wird letztlich auch hinsichtlich der materiellen Werte des Art. 2 AEUV größere Erfolge haben, wenn sie sich auf die formale Rechtsstaatlichkeit und hier auf die Unabhängigkeit der Gerichte konzentriert. Die formellen Elemente des Rechtsstaatsbegriffs sind handfester als die sehr allgemeinen sonstigen Werte des Art. 2 und als solche weitgehend konsentiert. Niemand stellt in Abrede, dass Richter und Gerichte unabhängig sein müssen. Niemand bezweifelt, dass fallbezogene Weisungen an die Justiz unzulässig sind. Die normative Anknüpfung findet sich in Art. 2 und Art. 19 I 2 EUV, der von den Mitgliedsstaaten die Einrichtung eines wirksamen Rechtsschutzes in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen verlangt. Art. 19 II 3 und Art. 253f AEUV behandeln die Unabhängigkeit der Richter nur als Persönlichkeitsmerkmal. Weiter wird Art. 47 der Grundrechte-Charta herangezogen. Wie genau die Gerichtsorganisation gestaltet sein muss, um die Unabhängigkeit der Gerichte herzustellen, lässt sich daraus zwar nicht ableiten.[12] Insbesondere die Berufung von Richtern bleibt in allen Staaten ein mehr oder weniger politisches Geschäft. Aber Richter, wenn sie wirklich unabhängig sind, sind eben doch keine Marionetten der Politik. Wirklich unabhängig sind sie aber nur, wenn sie vor einer nachträglichen negativen Änderung ihres Status geschützt sind. Das lässt sich als Grundsatz dem Urteil des EUGH vom 24. Juni 2019 entnehmen. Aber auch die (vom OLG Karlsruhe wiedergegebene) Bestimmung von Art. 42a des polnischen Gesetzes vom 20. Dezember 2019 ist rechtsstaatswidrig, denn sie entzieht bestimmte Rechtsfragen der Prüfung durch die Gerichte.
Ein Richterdisziplinarrecht muss sein, denn Richter sind auch nur Menschen. Disziplinarverfahren gegen Richter sind immer heikel und müssen ihrerseits am Ende von unabhängigen Richtern entschieden werden. Aber eine disziplinarische Maßregelung von Richtern, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den EUGH richten, kann die EU sich nicht gefallen lassen. Das ist eine klare Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit, die es erübrigt, aus mehreren Einzelmaßnahmen auf eine »systemische« oder »strukturelle« Verletzung richterlicher Unabhängigkeit zu schließen[13], ein Schluss, der dadurch befördert werden könnte, dass ein Staat die materiellen Werte des Art. 2 EUV anders interpretiert als die Mehrheit der Mitgliedsstaaten.
In dem EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips von 2014 hieß es: »Er ist keine Alternative zu Artikel 7 EUV, sondern er ergänzt ihn und dient eher dazu, eine Lücke im Vorfeld zu schließen.« Man darf aber wohl die Frage stellen, ob die Herstellung einer »Konditionalität zum Schutz des EU-Haushalts« durch Schaffung »komplementärer Instrumente«[14] nicht de facto eine Vertragsänderung darstellt, die »rechtsstaatlich« mit dem Vorrang der Verträge nur schwer in Einklang zu bringen ist.
Dies war der fünfhundertste Eintrag auf Rsozblog. Zum Jubiläum ist er etwas länger und grundsätzlicher ausgefallen.
[1] Felix Heidenreich, Unscharf gestellt. Politisches Sfumato, FAZ vom 2. 12. 2020.
[2] Carl Schmitt, Was bedeutet der Streit um den »Rechtsstaat«?, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 95, 1935, 189-201.
[3] Otto Kirchheimer, Zur Staatslehre des Sozialismus und Bolschewismus, Zeitschrift für Politik 17, 1928, 593-611, S. 597f.
[4] Ingo von Münch, Rechtsstaat versus Gerechtigkeit?, Der Staat 11, 1994, 165-184.
[5] Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1964, 2. Aufl. 1968.
[6] Das BVerfG leitet auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz aus dem Rechtsstaatsprinzip ab (z.B. E 70, 278/286). Doch das ist überflüssig, denn dieser Grundsatz ergibt sich ohne weiteres schon aus einem rationalen Umgang mit Werturteilen und der Logik von Mittel und Zweck.
[7] Joseph Raz, The Rule of Law and Its Virtue [1977], in: ders., The Authority of Law, Oxford 1979, 208-226; S. 210.
[8] Vgl. dazu aus der umfangreichen Literatur den Sammelband von Peter Cane (Hg.), The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Century, Oxford 2010, sowie Daniel Priel, Reconstructing Fuller’s Argument Against Legal Positivism, Canadian Journal of Law and Jurisprudence 26, 2013 = http://ssrn.com/abstract=2244594.
[9] Begriff von Julian Nida-Rümelin, Strukturelle Rationalität, 2001.
[10] Helmut Schelsky, Die juridische Rationalität, Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Sitzung am 23. April 1980 in Düsseldorf, 1980, Langfassung in: Schelsky, Die Soziologen und das Recht, 1980, 34-76.
[11] Albrecht Weber, Rechtsstaatsprinzip als gemeineuropäisches Verfassungsprinzip, ZÖR 63, 2008, 267-292.
[12] Zum Streitpunkt ist die Frage geworden, ob Unabhängigkeit nur für Gerichte im engeren Sinne zu fordern ist, oder ob auch andere staatliche Einrichtungen mit Kontrollfunktion wie Staatsanwaltschaften, Datenschutz- und Aufsichtsbehörden unabhängig sein sollen. In Deutschland ist die Staatsanwaltschaft traditionell weisungsgebunden (§146f GVG). Das wird zwar auch innerdeutsch kritisiert. Aber diese Kritik ist in erster Linie standespolitisch motiviert. 2019 hat der EUGH (C‑508/18) entschieden, dass deutsche Staatsanwälte keinen europäischen Haftbefehl beantragen dürfen, weil sie nicht als »ausstellende Justizbehörde« nach Art. 6 I des Rahmenbeschluss des Rates vom 13. 6. 2002 über den Europäischen Haftbefehl angesehen werden könne. Dieser Begriff sei dahin auszulegen, »dass darunter nicht die Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats fallen, die der Gefahr ausgesetzt sind, im Rahmen des Erlasses einer Entscheidung über die Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls unmittelbar oder mittelbar Anordnungen oder Einzelweisungen seitens der Exekutive, etwa eines Justizministers, unterworfen zu werden«.
[13] Julia Geneuss/Andreas Werkmeister, Faire Strafverfahren vor systemisch abhängigen Gerichten?, ZStW 132, 2020, 102-132; Anna Labedzka, The Rule of Law – A Weakening Lynchpin of the European Union, SSRN 2020, 3584379.
[14] Vgl. den »Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten« der Kommission vom 4. Mai 2018 (Ratsdokument Nr. 8356/18). Den der Bundesregierung in ihrer Eigenschaft als Ratsvorsitz m Ausschuss der Ständigen Vertreter vorgelegten Kompromisstext habe ich nicht gefunden.
Ähnliche Themen