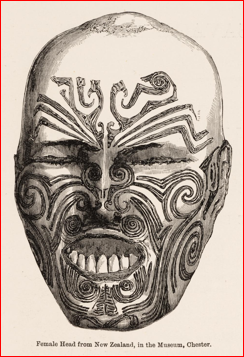Instrumente und Strategien feministischer Interessenpolitik
Dies ist die dritte und letzte Fortsetzung des Beitrags vom 4. 8. 2020.
V. Erfolge feministischer Interessenpolitik
Feminismus und Queerismus als soziale Bewegungen in Kombination mit ihrer wissenschaftlichen Basis können erstaunliche Erfolge verzeichnen. Zwar geht den Interessenten, die auf einen sozialen Wandel hinwirken, alles nicht weit genug und zu langsam. Aber Historiker werden später mit einiger Sicherheit von einer Revolution des Geschlechterarrangements sprechen.
Die aus deutscher Sicht wichtigsten Erfolge haben sich in Art. 3 GG niedergeschlagen. Die Fassung, die Art. 3 Abs. 2 GG im Parlamentarischen Rat erhielt, ist zugleich ein historisches Beispiel für die erfolgreiche Tätigkeit einer feministischen Aktivistin. 1948 wurde die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert vom Niedersächsischen Landtag in den Parlamentarischen Rat entsandt. Art. 109 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung hatte gelautet »Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.« Das hätte praktisch bedeutet, dass die verfassungsrechtlich garantierte Gleichheit sich nur auf das Wahlrecht und das Recht zu Bekleidung öffentlicher Ämter beschränkt hätte. Nach dem Entwurf des Ausschusses für Grundsatzfragen sollte es dabei bleiben. Selbert konnte aber binnen acht Wochen so viel Unterstützung mobilisieren, dass Art 3 Abs. 2 die aktuelle Fassung erhielt.[1] Damit konnten alle rechtlich greifbaren Diskriminierungen bekämpft werden, auch wenn dieser Prozess der Rechtsbereinigung noch Jahrzehnte in Anspruch nahm. Ein Meilenstein war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18. 3. 1953 (BVerfGE 3, 225), das klarstellte, dass Art. 3 Abs. 2 GG kein bloßer Programmsatz, sondern eine anzuwendende Rechtsnorm sei.
1994 erhielt Art. 3 Abs. 2 GG einen zweiten Satz, der lautet: »Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.« Damit gewann auch die praktische Gleichstellung von Männern und Frauen Verfassungsrang.
Im Anschluss an die Gleichbehandlungsrichtlinie des Europäischen Rates vom 9. 2. 1976 (76/207/EWG) erließen Bund und Länder so genannte Gleichstellungsgesetze. In Behörden und öffentlichen Einrichtungen aller Art wurden Frauenbüros eröffnet und Frauenbeauftragte bestellt. Heute heißen sie Gleichstellungsbeauftragte, um jedenfalls eine begriffliche Öffnung auch für Männer zu schaffen. Schließlich wurde das Gender Mainstreaming als Handlungsdevise der Politik installiert. Was in rechtlicher Hinsicht geschehen konnte, hat die Frauenbewegung erreicht, und nicht nur das, sie ist selbst ein Teil des Staates geworden.
Die Bewegung der Schwulen und Lesben brauchte länger, um auf dem Feld des Rechts erfolgreich zu sein. 1957 hatte das Bundesverfassungsgericht noch die Strafbarkeit der Homosexualität bestätigt.[2] Erst 1994 wurde der alte § 175 StGB aufgehoben. 2001 erging das Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft und seit 2017 gibt es die »Ehe für alle« (§ 1353 BGB n. F.). Das Bundes¬verfassungs¬gericht hat sich wiederholt der Situation der Trans- und Intersexuellen angenommen. Das letzte Glied in der Kette der Entscheidungen[3] ist der Beschluss vom 10. 10. 2017, in dem das Gericht die die Öffnung des Geburtenregisters für die Eintragung eines weiteren Geschlechts neben männlich und weiblich verlangt. Die Lektüre dieser Entscheidung führt direkt zu den Instrumenten und Strategien der Interessenverfolgung, die den sozialen Bewegungen und ihren wissenschaftlichen Unterstützern zur Verfügung stehen
VI. Instrumente und Strategien der Interessenverfolgung
In der politikwissenschaftlichen Literatur werden Strategien zur Interessenverfolgung durch Verbände aufgezählt.[4] Viele davon scheiden für die Wissenschaft aus. Aber Wissenschaft verfügt über andere Strategien.[5] Diese zeigen sich bei der Lektüre einschlägiger Verfassungsgerichtsentscheidungen.
1) Advokatorische Interessenvertretung
Liest man den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Geburtenregister von 2017, fällt als erstes auf, dass der Beschwerdeführer von zwei Rechtsprofessorinnen vertreten wurde, nämlich von Konstanze Plett und Friederike Wapler[6]. Plett hatte sich schon zuvor in ihren Veröffentlichungen der Problematik der Intersexuellen angenommen. Diese Art der Unterstützung durch die Wissenschaft ist als advokatorische Interessenvertretung geläufig. Für die Jahrzehnte vor der Jahrtausendwende ist in den USA von einer advocacy explosion[7] die Rede.
Solche Interessenvertretung geht jedenfalls in den USA mit einem social movement turn in law einher, mit einer Hinwendung der Rechtswissenschaft zu sozialen Bewegungen.[8] In den USA gab es seit den 1960er Jahren in der akademischen Jurisprudenz starke progressive Kräfte, die auf sozialen Wandel mit Hilfe der Gerichte setzten. Schwerpunktmäßig formierten sich diese Kräfte als Critical Legal Studies. Etwa gleichzeitig gab es mehrere Urteile insbesondere des US Supreme Courts von beinahe revolutionärem Format. Das wohl wichtigste war das Urteil in Sachen Brown v. Board of Education, das die Rassentrennung in den Schulen für unrechtmäßig erklärte. Der legal liberalism aktivistischer Juristen sah sich jedoch auf Dauer dem Problem gegenüber, dass sich die Grenze zwischen Recht und Politik nicht aufrecht erhalten ließ. Als Lösung des countermajoritarian problem, der Problems also, dass Juristen und Gerichte gegen Wähler- und Parlamentsmehrheiten agierten, erschien die Möglichkeit, auf soziale Bewegungen abzustellen, die neue Politiken fordern und die öffentliche Meinung in diesem Sinne verändern, so dass Juristen und Gerichte nicht selbst vorarangehen, sondern nur einen inzwischen gewachsenen politischen Konsens bestätigen. Ob dieses Modell überzeugt, muss hier offen bleiben. Aber jedenfalls scheint es eine progressive Jurisprudenz anzutreiben.
2) Politik- und Justizberatung durch Gutachten
Das Bundesverfassungsgericht bezieht sich auf verschiedene Gutachten. Die drei Autorinnen des von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veranlassten Gutachtens »Geschlechtervielfalt im Recht«, die im Deutschen Institut für Menschenrechte verankert waren, darf man wohl als feministisch orientierte Wissenschaftlerinnen einordnen. Im Vorwort dieser Gutachten dankt die Ministerin der Professorin Konstanze Plett für wissenschaftliche Beratung. Im Deutschen Ethikrat, auf den sich das Bundesverfassungsgericht wiederholt bezieht, ist dagegen aktuell keine explizit feministisch orientierte Wissenschaftlerin vertreten.
3) Verbands- und Sachverständigenanhörung
Grundsätzlich ist das Recht zur Teilnahme an einem Gerichtsverfahren auf die Parteien im weiteren Sinne beschränkt. Aber niemand hindert Dritte, sich mit einer Stellungnahme in das Verfahren einzumischen. Ob das Gericht die Stellungnahme zur Kenntnis nimmt, steht auf einem anderen Blatt. Solche Eimischung von Seiten der Wissenschaft hat in den USA als amicus curiae brief eine gewisse Tradition. Das Bundesverfassungsgericht ist dagegen frei, sachkundigen Dritten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (§ 27a BVerfGG).[9] Auf diesem Wege wird das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht »bei mündlicher Verhandlung zum öffentlichen Gespräch mit den für das jeweilige Gebiet relevanten politischen Kräften mit dem Ziel der Bewahrung oder Fortbildung des Verfassungsrechts.«[10]
Die Entscheidungsgründe des Beschlusses zum Geburtenregister referieren 16 Stellungnahmen von staatlichen und anderen Stellen, darunter sechs von NGO, die die Interessen von Queers vertreten. Natürlich lässt sich insoweit keine Kausalität feststellen. Die Entscheidung ist durch einen langen Diskussionsprozess angebahnt worden.[11] Aber dort stehen die Stellungnahmen aus der Wissenschaft und von Queer-NGOs auf einer Ebene mit den Stellungnahmen von Ministerien und Kirchen.
4) Interessenvertreter in Parteien, Parlamente und Regierungen
An dem Beschluss zum Geburtenregister hat auch die Professorin Susanne Baer mitgewirkt, allerdings nicht als Berichterstatterin. Soweit man das von außen beurteilen kann, nutzt sie ihre Richterstellung nicht zu blanker Interessenvertretung, sondern füllt ihr Amt in vornehmer Zurückhaltung aus.[12] Vermutlich hat sie jedoch einen starken indirekten Einfluss, weil mit ihrer Person und dem damit verbundenen wissenschaftlichen Werk das queerfeministische Anliegen allen Mitgliedern des Gerichts ständig präsent ist.
Frau Baer ist auf Vorschlag mit von Bündnis 90/Die Grünen in das Bundesverfassungsgericht gewählt worden. Die Grünen haben sich wie keine andere politische Partei queerfeministischer Interessen angenommen. Sie schauen auf über 30 Jahre engagierter Frauenpolitik zurück.[13] Die Parteistiftung der Grünen verbindet Wissenschaft und Politik in queerfeministischem Interesse.
5) Pingpong zwischen Soft Law und Hard Law
Das Bundesverfassungsgericht zitiert bei der Darstellung der Verfahrensgeschichte (Rn. 4) den durch die Frauenrechtskonvention von 1979 (CEDAW) eingerichteten Ausschuss, der 2009 die Bundesrepublik Deutschland aufforderte, »in einen Dialog mit Nichtregierungsorganisationen von intersexuellen und transsexuellen Menschen einzutreten, um ein besseres Verständnis für deren Anliegen zu erlangen und wirksame Maßnahmen zum Schutz ihrer Menschenrechte zu ergreifen«[14]. Dieses Zitat lässt sich als Hinweis auf das Wechselspiel zwischen national und international, zwischen Soft Law und Hard Law lesen. Die klassischen sozialen Bewegungen, wiewohl sie sich parallel in vielen Ländern entwickelten, von der Idee her als international verstanden und auch über Ländergrenzen hinweg Kontakte knüpften, blieben in ihren konkreten Aktionen doch immer in nationalen Grenzen gefangen. Erst die Umweltbewegung unter der straff organisierten Führung von Greenpeace schaffte den Durchbruch zu transnationalen Kampagnen. Während sich die Aktion gegen die Versenkung der Bohrinsel Brent Spar im Atlantik noch auf Westeuropa beschränkte, mobilisierte eine Kampagne gegen die chinesischen und französischen Atomwaffentests des Jahres 1995 die Weltöffentlichkeit. Das gelang in demselben Jahr auch der Weltfrauenkonferenz, die die Aufmerksamkeit der Weltpresse nicht allein wegen ihres Themas, sondern vor allem auch durch den Kleinkrieg mit den chinesischen Behörden gewonnen hat, der mit der Wahl Pekings als Austragungsort verbunden war.
Die UNESCO, die auch die Weltfrauenkonferenz koordiniert hatte, stellt den sozialen Bewegungen und ihren NGO das Spielfeld für ein Pingpong zwischen der nationalen und der internationalen Ebene zur Verfügung. Zu den internationalen Konferenzen finden Akteure aus der Zivilgesellschaft leichter Zugang als zu staatlichen Gesetzgebungsverfahren. Dort gelingt es ihnen, Beschlüsse durchzusetzen, die progressiver ausfallen, als es auf nationaler Ebene möglich wäre. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Beschlüsse zunächst nur unverbindliches Soft Law enthalten. Künftig beruft man sich auf nationaler Ebene dann jedoch auf internationale Standards, um seine Forderungen durchzusetzen. Die Frauenrechtskonvention als solche ist 1985 ratifiziert worden und hat damit den Rang eines Bundesgesetzes. Die Empfehlungen des Ausschusses, der NGOs großzügig Zugang gewährt, sind dagegen nur Soft Law.
VII. Mobilisierung der öffentlichen Meinung
Die Mobilisierung der öffentlichen Meinung ist der Königsweg der Interessenvermittlung, und dieser Weg steht auch der Wissenschaft offen. Es ist dem Thema angemessen, für den Begriff der Öffentlichkeit die Dreigliederung einer prominenten Feministin zugrunde zu legen. Danach ist die Öffentlichkeit zunächst rein faktisch eine kommunikative Arena. Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit ein Medium, mit dem sich eine diskursiv gebildete und darum legitime Meinung als politische Kraft zur Geltung bringt. Schließlich ist die öffentliche Meinung mehr oder weniger effektiv.[15]
Eine Strategie, die jeder Wissenschaftsdisziplin zur Verfügung steht, um sich als politische Kraft zur Geltung zu bringen, besteht darin, »Meinungen als verallgemeinerbare Meinungen zu plausibilisieren«[16]. Damit war die Geschlechterforschung hinsichtlich der Egalitätsforderung für Frauen und der Toleranzforderung gegenüber den Queers weitgehend erfolgreich. Die Massenmedien sind bemüht, sowohl bei den gesellschaftlichen Eliten[17] als auch für die Lebenswelt des Publikums die Repräsentationsforderungen von Feminismus und Queerismus zu erfüllen. Insoweit hat die Geschlechterforschung nicht nur die so genannten Intellektuellen und damit einen erheblichen Teil der Medien- und Kunstszene für sich eingenommen, sondern weithin auch das Publikum. Dagegen ist es der Geschlechterforschung kaum gelungen, die Forderung nach »Auflösung der Geschlechterdifferenz« zu plausibel zu machen. Der Abolitionismus der Queer-Theorie bleibt akademisch.
Die Einwirkung der Geschlechterforschung auf die öffentliche Meinung läuft nicht nur über die Plausibilisierung feministischen Wissens, sondern auch über einen »diskursiven Klassenkampf«[18]. Kampfbasis ist zunächst eine eigene Medienwelt. Es wäre eine Untersuchung wert, die feministische Literaturproduktion zu quantifizieren und vielleicht auch zu qualifizieren. Bei der Vorbereitung dieses Vortrags bin ich aus dem Staunen nicht herausgekommen.
Aus der feministischen Medienwelt heraus wächst der diskursive Klassenkampf mit Texten als politischer Aktivität.[19] Bei der Strukturierung des moralisch-rechtlichen Diskurses ist »Gender« zu einer diskurstragenden Kategorie geworden. Dieser Einfluss verläuft nicht ohne, aber auch nicht allein über Sachargumente, sondern hängt auch an der Artikulationsfähigkeit und der Ausdauer der Beteiligten. Insoweit hat die Geschlechterforschung sich als sehr leistungsfähig erwiesen.
Frauenbewegung und Queerismus nehmen qua Wissenschaft den »Willen zur Wahrheit« (Foucault) für sich in Anspruch. Sie bemühen sich recht erfolgreich, die Gegenkräfte als inkompetent darzustellen und sie ins politische oder moralische Abseits zu drängen.[20] Dazu wird auch sachliche Kritik als »anti-« oder »feindlich«[21] zurückgewiesen. Die einschlägigen Diskursfiguren werden wissenschaftlich vorbereitet und von intermediären Akteuren als »Argumentationshilfen«.[22] Der fraglos vorhandene unsachlich polemische rechtspopulistische Antifeminismus bietet Gelegenheit, kritische Stimmen als »neoreaktionär« zurückzuweisen.[23] Antifeministische und maskulinistische Stimmen finden sich praktisch nur in der unorganisierten Online-Öffentlichkeit[24]. In den etablierten Medien ist allenfalls ein Raunen über politische Korrektheit wahrzunehmen. Die mediale Konsonanz ruft Noelle-Neumanns Theorie von der Schweigespirale in Erinnerung.
Ohne die Unterstützung der Gender Studies ist die Sichtbarkeit feministischer und queer-feministischer Interessen in den Medien kaum erklärbar. Insoweit ist eine gewisse Effektivität gegeben. Als kommunikative Arena hat die Öffentlichkeit jedoch eine Eigendynamik entwickelt, deren Ergebnis von der Geschlechterforschung als neoliberaler Popularfeminismus kritisiert wird. Das betrifft sowohl die feministische Egalitätsforderung als auch die queertheoretische Heteronormativitätskritik.[25]
Was zunächst die Egalitätsforderung betrifft, so ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Standardthema der Medien. Zwar wird dabei die ungleiche familiäre Arbeitsteilung angesprochen. Doch letztlich werden die Probleme auf die Unzulänglichkeit öffentlicher Kinderbetreuung abgeschoben und das traditionelle Familienbild bestätigt. Vor allem aber wird der Feminismus am Beispiel von Karrierefrauen als Erfolgsgeschichte dargestellt. Aus der Mitte der Medienwelt, vom »Spiegel«[26] und von der »Zeit«[27], wurde die Forderung nach einem neuen pragmatischen Feminismus artikuliert.[28] Die Kritik aus der Geschlechterforschung macht geltend, damit werde das strukturelle Problem individualisiert, aus dem politischen Anliegen des Feminismus werde ein »Selbstverwirklichungsprojekt für Privilegierte«[29]. Nancy Fraser hält der neuen Frauenbewegung vor, sie habe feministische Grundsatzkritik an einen pseudolinken Neoliberalismus verraten. »Zum Maßstab der Emanzipation avancierte der Aufstieg von ›talentierten‹ Frauen, Minderheiten, Schwulen und Lesben in der kommerziellen Winner-take-all-Hierarchie – und nicht mehr deren Abschaffung.«[30]
Erst recht die sozialen Medien konterkarieren die Öffentlichkeitsarbeit der Geschlechterforschung. Zwei Untersuchungen von NGOs, nämlich von der Maria- und Elisabeth-Furtwängler-Stiftung Malisa und von dem Kinderschutzverein Plan International zeigen, dass in den Sozialen Medien die traditionellen Rollenbilder lebendig sind.[31]
Nicht viel anders ergeht es den queerfeministischen Genderthemen. Die Medien greifen sie gerne auf, denn mit Gender verbindet das Publikum immer auch Sex, und Sexthemen haben einen hohen Erlebnis- und Unterhaltungswert. Daher dringen Stellungnahmen der Gender Studies bis in die Boulevardmedien vor. Ein Beispiel ist bietet die Gynisierung der Männer[32].
Die Queers ziehen ein größeres Medien- und Kunstecho auf sich als der ältere Feminismus. Das liegt an den internen Gesetzmäßigkeiten von Medien und Kunst. Die Medien suchen nach dem Abweichenden, Auffälligen. Das Normale ist langweilig. Die Kunst braucht das Schillernde, Zweideutige, eben den Regenbogen.[33] Selbst Bayreuth schmückt sich mit einer Dragqueen. Andererseits sind Queers anscheinend künstlerisch besonders begabt und innovativ.[34] Die Medien haben insofern eine gewisse Affinität zu den Queers, als nicht wenige ihren Beruf in der Unterhaltungsindustrie suchen. Elton John, Hape Kerkeling und Conchita Wurst sind prominente Beispiele. Ihr Publikum lässt sich die Unterhaltung gerne gefallen. Ähnliches gilt für die Modebranche, wo allerdings nur das High End mit einem fluiden Geschlechtsbild kokettiert, während die Konsummode es bei Gendermainstreaming mit Unisex-Jeans belässt.
Zur kommunikativen Arena gehört auch die Werbung. Die von der Queer- Theorie als neoliberal kritisierte Wirtschaft lässt sich keine Chance zur Werbung und zur Weckung von Konsumbereitschaft entgehen. Schwule Männer gelten als besonders kaufkräftig. Regenbogen-Marketing liegt daher im Trend. [35]
Von feministischer Seite wird kritisiert, dass es in den Medien an »einer grundlegenden Kritik am symbolischen System der Zweigeschlechtlichkeit oder einer Infragestellung gesellschaftlicher Machtverhältnisse entlang der Trias von race, class, gender« fehle.[36]
VIIII. Schluss: Das Dilemma bleibt
Geschlechterforschung will parteilich sein.[37] Partei für wen? Ein Feminismus, der für die Mehrheit der Frauen sprechen will, muss wohl an der Heterosexualität als natürlichem und sozialem Normalfall festhalten. Von einem solchen Feminismus ist der Versuch zu erwarten, die binäre Geschlechternorm so zu gestalten, dass sie für beide Geschlechter vorteilhaft wird und zugleich den Queers Raum lässt. Schon immer war es das Dilemma des Feminismus, dass er einerseits das Geschlecht als Analysekategorie zugrunde legen musste, andererseits aber die Differenz zum anderen Geschlecht nicht weiter qualifizieren wollte. Das Dilemma wird durch den in die Gender Studies eingebauten Zielkonflikt zwischen Heterosexualität und fluidem Geschlecht verfestigt. Die Allianz mit der Queer-Theorie hindert den Feminismus, ein positives Frauenbild zu formulieren. Die Frage, welche positive Rolle für Männer Platz greifen könnte, wenn diese denn endlich ihre hegemonialen Attitüden abgelegt hätten, wird nicht einmal gestellt.
Nachtrag: Das vollständige Vortragsmanuskript steht jetzt bei SSRN zu Verfügung: Roehl, Klaus F., Feminismus, Gender Studies und Rechtsentwicklung: Geschlechterforschung als Interessentenwissenschaft (Feminism, Gender Studies and Legal Development: Gender Studies As Interest Group Scholarship) (August 1, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3665173 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3665173.
[1] Ich habe nicht selbst recherchiert, sondern beziehe mich auf Jutta Limbach, Elisabeth Selbert und ihre Sternstunde im Parlamentarischen Rat am 18. Januar 1949; Michael Wrase/Alexander Klose, Gleichheit unter dem Grundgesetz (§ 4), in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft, 2. Aufl. 2012, S. 89-108, S. 89.
[2] BVerfGE 6, 389-443 (Bestätigung der Strafbarkeit der Homosexualität).
[3] BVerfGE 49, 286-304 (Anerkennung der Transsexualität); BVerfGE 85, 191-214 (Nachtarbeitsverbot für Frauen unzulässig, hier nahm das Gericht Stellungnahmen des Deutschen Juristinnenbundes und des Deutschen Frauenrings zur Kenntnis); BVerfGE 88, 87-103 (Schwangerschaftsabbruch II; keine Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung); BVerfGE 105, 313-365 (Eingetragene Lebenspartnerschaft kein Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 GG. Hier nimmt das Gericht Stellungnahmen des Lesben- und Schwulenverbands sowie der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche zur Kenntnis); BVerfGE 115, 1-25 Transsexuelle III – (gehört werden die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und der sonntags.club); BVerfGE 128, 109-137 (Lebenspartnerschaft von Transsexuellen).
[4] Z. B. bei Martin Sebaldt/Alexander Straßner, Verbände in der Bundesrepublik Deutschland, 2004, S. 19f.
[5] Die »traditionalen und provokativen Strategien der Interessensdurchsetzung« des Arbeitskreises Wissenschaftlerinnen in NRW, wie sie Sigrid Metz-Göckel beschreibt, dienten der unmittelbaren Interessenwahrnehmung der beteiligten Wissenschaftlerinnen (Grenzgänge zwischen Feminismus und Politik oder die Eroberung des Politischen, in: Barbara Rendtorff u. a. (Hg.), 40 Jahre Feministische Debatten, Resümee und Ausblick, 2014, 178-191. Die Vermittlung von nicht unmittelbar wirtschaftlichen Interessen, insbesondere von Parteien, Kirchen, Religionsgemeinschaft und Verbänden aus dem Gesundheitswesen, behandelt Thomas Gawron, Bundesverfassungsgericht und Organisierte Interessen, 2019.
[6] Wapler ist 2015 durch ein Gutachten über »Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare« im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung hervorgetreten. Vgl. jetzt auch Friederike Wapler, Politische Gleichheit: Demokratietheoretische Überlegungen, Jahrbuch des öffentlichen Recht NF 67, 2019, 427455.
[7] Jeffrey M. Berry/Clyde Wilcox, The Interest Group Society, 6. Aufl., 2018, S. 19ff. Von einer advocacy explosion sprach Berry schon in der ersten von ihm allein besorgten Auflage von 1984.
[8] Scott L. Cummings, The Social Movement Turn in Law, Law & Social Inquiry 43 , 2018, 360-416.
[9] Ergänzt wird die Bestimmung durch § 22 Abs. 5 der Geschäftsordnung des BVerfG: »Auf Vorschlag des berichterstattenden Mitglieds des Senats oder auf Beschluss des Senats ersucht der oder die Vorsitzende Persönlichkeiten, die auf einem Gebiet über besondere Kenntnisse verfügen, sich zu einer für die Entscheidung erheblichen Frage gutachtlich zu äußern.«
[10] Klaus Schlaich/Stefan Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11. Aufl., 2018, § 27a BVerfGG Rn. 66.
[11] Diesen Diskussionsprozess rekapituliert Elisabeth Holzleithner in einer ausführlichen Würdigung der Entscheidung (Geschlecht als Anerkennungsverhältnis, Jahrbuch des öffentlichen Recht NF 67, 2019, 457-485.
[12] Über Amtsverständnis und erste Erfahrungen Susanne Baer im Interview: »Die Geschlechtergleichstellung hat eine etwas ambivalente Situation erreicht«, Femina Politica, 2012/2, 24-37. Die Äußerung einer wissenschaftlichen Meinung zu einer Rechtsfrage, die für das Verfahren bedeutsam sein kann, ist nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 BVerfGG kein Befangenheitsgrund. Das muss auch für wissenschaftliche Meinungen zu Sachfragen gelten, die nur mittelbar für die Rechtsfrage relevant sind. Dagegen wird von Erna Scheffler, der ersten Richterin am Bundesverfassungsgericht, gesagt, sie habe maßgeblich auf die Rechtsprechung des Gerichts zur Gleichberechtigung eingewirkt (Ursula Rust, Die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-Gerichts zur garantierten Gleichberechtigung, Aus Politik und Zeitgeschichte B37-38/2001, S. 26-33; Michael Wrase/Alexander Klose, Gleichheit unter dem Grundgesetz (§ 4), in: Lena Foljanty/Ulrike Lembke (Hg.), Feministische Rechtswissenschaft, 2. Aufl., 2012, 89-108, S. 91).
[13] 30 Jahre Grüne Frauenpolitik – Mission erfüllt? 19. April 2013 von Barbara Unmüßig/Marie-Theres Knäpper.
[14] CEDAW/C/DEU/ CO/6 Nr. 62.
[15] Nancy Fraser, Die Transnationalisierung der Öffentlichkeit. Legitimität und Effektivität der öffentlichen Meinung in einer postwestfälischen Welt, in: Johanna Dorer u. a. (Hg.), Medien – Politik – Geschlecht. Feministische Befunde zur politischen Kommunikationsforschung, 2008, S. 18-34. S. 18f.
[16] Jürgen Gerhards/Friedhelm Neidhardt, Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit, 1990, S. 11.
[17] Kritisch noch Beiträge in dem Sammelband von Jutta Röser/Margreth Lünenborg (Hg.), Ungleich mächtig. Das Gendering von Führungspersonen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in der Medienkommunikation, 2012, sowie Elisabeth Klaus/Margreth Lünenborg, Zwischen (Post-) Feminismus und Antifeminismus. Reflexionen zu gegenwärtigen Geschlechterdiskursen in den Medien, Gender 5, 2013, 78-93.
[18] Sabine Hark, Dissidente Partizipation, 2005, S.34. Klassenkampf steht dort in Anführungszeichen.
[19] Sabine Hark, Dissidente Partizipation, 2005, S. 34.
[20] Artikel von Volker Zastrow in der FAZ und von René Pfister im Spiegel werden dem »extrem rechten Diskurs um Gender« zugeordnet (Juliane Lang, Familie und Vaterland in der Krise. Der extrem rechte Diskurs um Gender, in: Sabine Hark/Paula-Irene Villa (Hg.), Anti- Genderismus, Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, 2015, S. 167-181). Wer es wagt, natürliche Unterschiede zwischen Mann und Frau anzuführen, wird zum symbolischen Gewalttäter (Irene Dölling, Symbolische Gewalt in aktuellen Diskursen zum Anti- bzw. Neo-Feminismus, in: Daniel Suber u. a. (Hg.), Pierre Bourdieu und die Kulturwissenschaften, 2011, S. 179-197).
[21] Vgl. Elisabeth Holzleithner, Geschlecht als Anerkennungsverhältnis, Jahrbuch des öffentlichen Recht NF 67, 2019, 457-485, S. 485 bei Fn. 170.
[22] Die Böll-Stiftung und die Friedrich Ebert-Stiftung haben entsprechende Argumentationshilfen zusammengestellt: Melanie Ebenfeld/Manfred Köhnen (Hg.), Gleichstellungspolitik kontrovers. Eine Argumentationshilfe, 2011; Regina Frey/Gärtner/Manfred Köhnen/Sebastian Scheele, Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie, Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse, 2013.
[23] Vgl. das Schwerpunktheft »Normalisierung reaktionärer Politiken« der Zeitschrift Feministische Studien (Band 36 Heft 2, 2018).
[24] Ricarda Drüeke/Elisabeth Klaus, Öffentlichkeiten im Internet: Zwischen Feminismus und Antifeminismus, Femina Politica 2014/2, 59-71. Ähnlich schon Ilse Lenz im Interview, Freiburger Zeitschrift für Geschlechterstudien 22, 2016, 125-136.
[25] Günter Burkart (Soziologie der Paarbeziehung, 2018, S.227) empfiehlt, zwischen Diskurs und Normen der Praxis zu unterscheiden. Anscheinend folgt die Praxis dem feministischen Diskurs nur mit großem Abstand.
[26] Spiegel Special 1/2008: »Das starke Geschlecht«, darin Barbara Supp u. a., Die Alphamädchen.
[27] Heike Faller, Wir brauchen einen neuen Feminismus, Die Zeit Nr. 35 vom 24. 8. 2006.
[28] Dazu gut und kritisch mit vielen Nachweisen Brigitte Friederike Gesing, »Das Private ist politisch« revisited: Zum Mediendiskurs um einen Neuen Feminismus in Deutschland, Abschlussarbeit im Fach Gender Studies/Geschlechterstudien, Humboldt-Universität, Berlin 2008.
[29] Gesing a. a. O. S. 2.
[30] Nancy Fraser, Feminismus, Kapitalismus und die List der Geschichte, Blätter für deutsche und internationale Politik, 2009, 43-57.
[31] Für die USA hat Donna Zuckerberg diesen Gesichtspunkt aufgegriffen (Not All Dead White Men. Classics and Misogyny in the Digital Age, 2018). Zuckerberg kritisiert, dass sich im Internet aktiven Maskulinisten auf antike Klassiker berufen. Darin liegt in der Tat ein normativer Rückschaufehler. Freilich begeht Zuckerberg den gleichen Fehler in umgekehrter Richtung, indem sie eben diesen Klassikern Misogynie vorzuhält.
[32] Stefan Hirschauer, Mein Bauch gehört uns. Gynisierung und Symmetrisierung der Elternschaft bei schwangeren Paaren, Zeitschrift für Soziologie 48, 2019, 6-22. Dazu Gerald Wagner, Wie schwanger können Männer werden?, FAS vom 12. 5. 2019.
[33] Vgl. dazu die Einleitung von Penny Farfan, Performing Queer Modernism, New York, NY 2017.
[34] Florida, Richard (2002), The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York; ders., The Rise of the Creative Class. Why Cities without Gays and Rock Bands are Loosing the Economic Development Race, The Washington Monthly, Mai 2002, S. 15-25. In der Queer-Theorie wird »engagierte Ekphrasis« als Strategie erörtert (Engel).
[35] Antke Engel, Bilder von Sexualität und Ökonomie. Queere kulturelle Politiken im Neoliberalismus, 2009; FAZ vom 13. 10. 2019 S. 21: Das Geschäft mit der Toleranz. Immer mehr Einzelhändler werben mit Regenbogenprodukten. Aus der Werbewirkungsforschung: Martin Eisend/Erik Hermann, Consumer Responses to Homosexual Imagery in Advertising: A Meta-Analysis, Journal of Advertising 48, 2019, 380-400; dies., Sexual Orientation and Consumption: Why and When Do Homosexuals and Heterosexuals Consume Differently?, International Journal of Research in Marketing, 2020, online.
[36] Elisabeth Klaus/Margreth Lünenborg, Zwischen (Post-)Feminismus und Antifeminismus. Reflexionen zu gegenwärtigen Geschlechterdiskursen in den Medien, Gender – Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft 5, 2013, 78-93, S. 89.
[37] Christa Müller, Parteilichkeit und Betroffenheit, in: Ruth Becker u. a. (Hg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, 2010, S. 340-343.
Ähnliche Themen