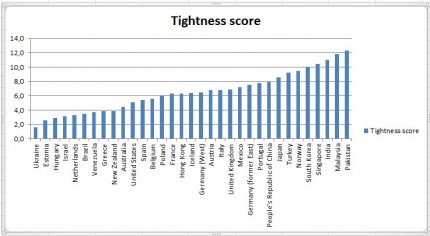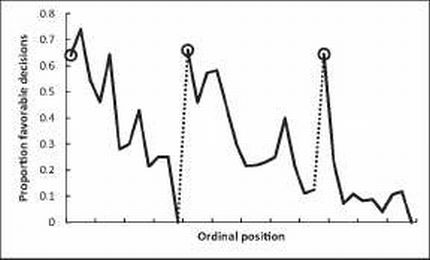Zu den Berichten, die ich in meinen Einträgen zur Berichtsforschung im Blick hatte, gehört der Bericht der UNO Commission on Legal Empowerment of the Poor »Making the Law Work for Everyone«. Es handelt sich um eine Kommission unter dem Dach des United Nations Development Programme (UNDP) in New York. Vorsitzende waren die ehemalige amerikanische Außenministerin Madeleine Albright und der peruanische Ökonom Hernando de Soto. 2008 hat die Kommission einen zweibändigen Bericht abgeliefert:
Der erste Band mit seinen 96 Seiten ist mit vielen Bildern und buntem Design wie eine Public-Relations-Broschüre aufgemacht. Man kann ihn wie ein Management Summary lesen. Als solches bietet er klare Kernaussagen und darüber hinaus ganz interessante Hinweise und Inhalte. Die dramatische Basisaussage: Vier Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Recht. Der zweite Teil mit seinen 353 Seiten ist nüchterner im Stil eines wissenschaftlichen Gutachtens gehalten. Es wird viel Literatur ausgewertet, und es werden illustrative Einzelbeispiele herangezogen. Aber es gibt keine systematische Datenerhebung.
Ein gute Übersetzung für Legal Empowerment ist mir bisher nicht eingefallen. »Zugang zum Recht« trifft die Sache nicht ganz. Blankenburgs »Mobilisierung des Rechts« [1]Erhard Blankenburg, Mobilisierung des Rechts, Eine Einführung in die Rechtssoziologie, Berlin 1995. gefällt mir auch nicht 100%ig, weil sie auf die Aktivierung der Betroffenen abstellt. Das Problem beginnt nicht erst, wenn die Menschen nach Institutionen suchen, die ihnen helfen könnten, und sie sich bei diesen mit ihrem Anliegen durchsetzen müssen. Bei sehr vielen Menschen beginnt das Problem noch früher damit, dass sie keine legale Existenz haben, keinen amtlich registrierten Namen und folglich keinen Ausweis. Es fehlt damit die rechtliche Identität, an die der rechtliche Schutz von Eigentum und Vertragsrechten anknüpfen kann. Es fehlt die Identität vor Banken und Behörden. Mit Interesse hatte ich deshalb schon vor Jahr und Tag einen Zeitungsartikel von Christoph Hein mit der Überschrift »Eine Nummer für jeden Inder« gelesen. [2]FamS vom 14. 2. 2010 (S. 39). Bisher gibt es in Indien keinen Pass oder Personalausweis für jedermann, sondern nur zweckgebundene Einzelausweise. Hein: »Wer Steuern zahlt, bekommt eine PAN, die Nummer für ein Steuerkonto. Wer älter als 18 Jahre ist, wird im Wahlregister vermerkt. Die Armen erhalten Karten für Nahrungsrationen. Die im Ausland lebenden Inder haben den Status des NRI – des Non-Resident Indian.« Man kann sich leicht vorstellen, wie sehr dieser Zustand die Verwaltung des riesigen Landes erschwert. Deshalb hat die indische Regierung den Milliardär und Gründer von Infosys, Nandan Nilekani, beauftragt hat, 1,2 Millionen Inder mit einem Personalausweis zu versehen.

(Nandan M. Nilekani nach einem Foto von E.T. Studhalter für das World Economic Forum 2007)
Nilekani ist nunmehr Leiter der Unique Identification Authority of India im Range eines Ministers. Nach dem Bericht von Christoph Hein zu urteilen, hat Nilekani die Aufgabe, hier Abhilfe zu schaffen, aber nicht übernommen, um der Verwaltung beizuspringen, sondern er sieht sie als eine soziale Aufgabe an.
Wie belastend ihr Zustand für die Ausweislosen ist, steht nicht ganz außer Frage. Die Doing-Business-Reports der Weltbank und ähnliche Berichte gehen einhellig davon aus, dass die Klarheit der Zuordnung von Eigentumsrechten, die Sicherheit des Eigentums und die Durchsetzbarkeit von Verträgen der Wirtschaft helfen. Autoren aus dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik weisen jedoch darauf hin, dass diese Annahme für den Informellen Sektor, der in den armen Entwicklungsländern für die Wirtschaft erhebliche Bedeutung hat, nicht zutreffen müsse. [3]Tilman Altenburg, Christan von Drachenfels, (2006): The ‘New Minimalist Approach’ to Private- Sector Development: A Critical Assessment. In: Development Policy Review, 24, 2006, 387–411; dies. … Continue reading Sie berufen sich auf Studien, nach denen die Registrierung von Grundeigentum und Unternehmen für den informellen Sektor keine Bedeutung habe.
Die Eintragung von Grundeigentum kann sogar kontraproduktiv wirken, weil die Bodennutzung in manchen Regionen in einer Weise informell geregelt ist, die auch den Schwächsten noch eine gewisse Nutzungsmöglichkeit bietet. Die Registrierung von Grundeigentum führe dagegen zur Exklusion und zur Spekulation. Dem lässt sich wieder der Bericht der UNO Commission on Legal Empowerment of the Poor entgegenhalten. Darin wird an einem Beispiel aus Kenya gezeigt, wie wichtig die Registrierung von Grundeigentum für den Zugang zum Recht sei. Ohne registriertes Eigentum hätten die Bewohner keine Chance zur Gegenwehr, wenn Behörden oder Unternehmen ganze Siedlungen abreißen, um neu und modern zu bauen.
Im Ergebnis wird man wohl sagen müssen: Sobald die Modernisierung eines Landes einmal eingesetzt und die alten sozialen Strukturen zerstört hat, geht es nicht mehr ohne die rechtliche Identität.
Anmerkungen
| ↑1 | Erhard Blankenburg, Mobilisierung des Rechts, Eine Einführung in die Rechtssoziologie, Berlin 1995. |
|---|---|
| ↑2 | FamS vom 14. 2. 2010 (S. 39). |
| ↑3 | Tilman Altenburg, Christan von Drachenfels, (2006): The ‘New Minimalist Approach’ to Private- Sector Development: A Critical Assessment. In: Development Policy Review, 24, 2006, 387–411; dies. und Matthias Krause, Seven Theses on Doing Business. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2008; Miguel Jaramillo, Is there Demand for Formality among Informal Firms? Evidence from microfirms in downtown Lima, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 2009. |