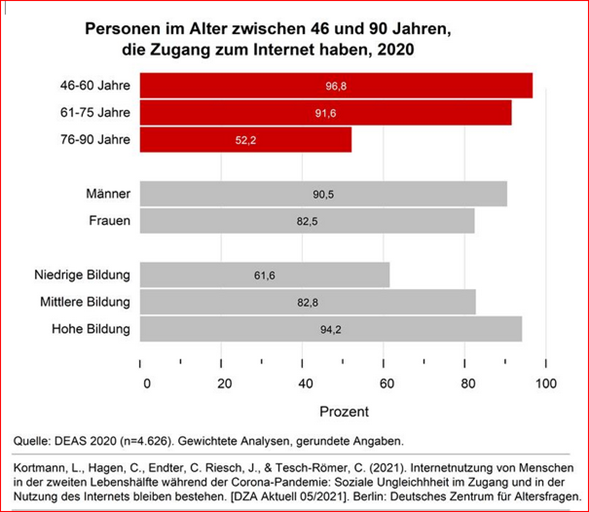Kritik der Soziobiologie Teil I
Im Eintrag über Ernst-Joachim Lampes »Historiogenese des Rechts« habe ich auf zwei weitere Neuerscheinungen hingewiesen:
Dieter Krimphove, Rechtsethologie. Die Ableitung des Rechts aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen, Duncker & Humblot, Berlin, DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-58217-4. 322 S.
Axel Montenbruck, Naturethik; Bd. 1 »Universelle Natur- und Schwarmethik«, 2021, Bd. 2 »Biologische Natur- und Spielethik«, Bd. 3 »Naturalistische Kriminologie und Pönologie«, im Open Access bei der FU Berlin.
Beide Titel sind von Benno Heussen, der sich kurz zuvor seinerseits auf die »Suche nach den biologisch-psychologischen Wurzeln des Rechts« begeben hatte[1], lobend rezensiert worden. Das kann nicht auf sich beruhen. Zunächst will ich auf das Buch von Krimphove eingehen, wiewohl vermutlich viel von dem Gesagten auch für das Machwerk Montenbrucks gilt, das durchgehend zu lesen ich mich bisher geweigert habe.
Um das Buch von Krimphove einzuordnen, ist ein Rückblick auf die Soziobiologie – teilweise spricht man auch von Biosoziologie – notwendig, denn trotz aller Beteuerungen des Autors über die Neuartigkeit und Interdisziplinarität seines Ansatzes, handelt es sich im Kern um eine evolutionsbiologische Ausmalung des Rechts. Es ist lange her, dass ich mich mit dieser Thematik befasst habe. Die folgenden Ausführungen dienen daher der Selbstverständigung. Für den Kenner bieten sie nicht Neues. Vielleicht helfen sie dem, der sich näher mit der Materie befassen will, insbesondere durch die Literaturhinweise, zu einem schnelleren Einstieg. Vorab sei daher auf einige Übersichtsarbeiten hingewiesen, die mir besonders geholfen haben: Als Einstieg diente die immer noch nicht überholte Kritik der Soziobiologie von Dirk Richter.[2] Erst relativ spät habe ich die noch zwei Jahre ältere Stellungnahme von Heiner Rindermann[3] entdeckt, (die Richter ignoriert) und die mir interessant erscheint, weil sie detaillierter auf die (zweifelhafte) Beweiskraft evolutionstheoretischer Argumentation und deren normative Implikationen eingeht. Ein ordentliches Referat über Erträge der Evolutionsbiologie bietet die Dissertation von Patrick Riordan.[4] Eine ausführliche Analyse der Beziehungen von Soziologie und Biologie von den Anfängen bis heute bieten Russel K. Schutt und Jonathan H. Turner.[5] In einem zweiten Teil entwickeln sie eigene Vorstellungen über eine evolutionsbiologisch informierte Soziologie.[6] Mein Eindruck geht dahin, dass man in der Soziologie etwas Abstand vom kulturellen Konstruktivismus gewonnen und (wieder) stärker an Evolutionstheorie[7] und darüber auch an Biologie[8] anzuknüpfen versucht.
Die Kombination von Evolutionstheorie und Soziobiologie, um die es hier geht, fand und findet nicht nur in Publikumsmedien ein großes Echo. Sie stand als »Rechtsbiologie« zeitweise auch bei Juristen hoch im Kurs.[9] Von dem amerikanischen Juristen Edwin Scott Fruehwald stammen zusammenfassende Darstellungen von Ergebnissen, die für das Recht relevant sein sollen. Sie sind kurz, klar und lesbar geschrieben und zudem leicht zugänglich, so dass darauf für einen ersten Eindruck verwiesen werden kann. Was Fruehwald affirmativ berichtet, wirkt auf mich allerdings weitgehend wie eine Spekulation von Amateur-Evolutionsbiologen. Es ist schwer vorstellbar, dass das alles wirklich auf der Gen-Ebene nachgewiesen ist. Es scheint vielmehr so, dass geläufige individualpsychische und soziale Phänomene (um nicht zu sagen Stereotype) in die Entwicklungsgeschichte der Menschheit und von dort in die Biologie hineininterpretiert werden. Auf diesem Wege suchen Juristen ihre Vorstellungen von der Welt und deren Recht in den Genen. Was auch immer ihnen an Trivial-Psychologie und Soziologie durch den Kopf geht, findet eine natürliche Erklärung. Dahinter steht die vage Hoffnung, in der »Natur« eine Stütze für die immer wieder schwierigen Entscheidungen zu finden, die die Jurisprudenz zu treffen hat. Das ist im Grunde auch schon der Tenor meiner Kritik an dem Buch Krimphoves.
Die Soziobiologie wurde von Edward O. Wilson (Sociobiology. The New Synthesis, 1975) und Richard Dawkins (The Selfish Gene,1976) auf den Weg gebracht und alsbald durch eine evolutionäre Psychologie flankiert. Diese Soziobiologie löste einen Wissenschaftskrieg[10] aus, der mit Protesten und Sprechverboten der aktuellen Auseinandersetzung der Community der Transmenschen und ihrer Unterstützer mit dem Feminismus von Kathleen Stock ähnelt. Einen Höhepunkt erreichte der Nativismus, also die Annahme, dass Persönlichkeitszüge und kulturelle Universalien biologisch programmiert sind, mit Steven Pinkers »Blank Slate« 2002.[11] Ich staune aber immer wieder, wie differenziert Bericht und Stellungnahme Pinkers – die ich bislang nicht selbst gelesen hatte – ausfallen. Das gilt auch für seinen Bericht über den »Wissenschaftskrieg«, in dem er geltend macht, dass die Kritiker der Soziobiologie die einschlägigen Texte gar nicht ernsthaft zur Kenntnis genommen haben.
Die Soziobiologie steht unter dem Verdacht eines biologischen Reduktionismus und genetischen Determinismus. Ihr wird die Unterwanderung einer (kritischen) Sozialwissenschaft durch biologistische Pseudoempirie vorgeworfen. Aus feministischer Sicht wird die (begründete) Befürchtung geäußert, dass Soziobiologie Vorstellungen von Heterosexualität und Monogamie sowie eine evolutionär funktionale Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern rechtfertigen könnte.[12] Die Soziobiologie ist schließlich ist Gegenstand der Kapitalismuskritik: In Dawkins egoistischem Gen spiegelt sich der homo oeconomicus mit seinem Nutzenkalkül. Deshalb kritisieren Deus u. a., »die evolutionistische Deutung der Gesellschaft als hoch individualisierter Überlebenskampf aller gegen alle sei nichts anderes als eine Projektion kapitalistischer Marktmachtverhältnisse auf die gesamte belebte Natur«.[13]
Das Determinismusproblem ist auch in diesem Zusammenhang unlösbar. Der Vorwurf des Reduktionismus trifft besonders Edward O. Wilson, der die Soziobiologie als neue Einheitswissenschaft begründen wollte, die auch Sozial- und Geisteswissenschaft einschließen soll. Hier stellt sich wieder die Frage nach dem Geist der Geisteswissenschaften.[14] Ohne Bezug auf Wilson, aber mit ausführlicher Stellungnahme zum Evolutionsgeschehen meint Günter Dux, den Geist »erkenntniskritisch« retten zu können.[15] Es führt kein Weg daran vorbei: Der menschliche Geist, Gedanken und Erinnerungen, Handlungen und Gefühle und schließlich auch das Bewusstsein entstehen aus dem Zusammenspiel elektrochemischer Signale im Nervensystem. Die üblichen Stichworte Autonomie und Emergenz des sozial-kulturellen Systems sind nur Rettungsringe. So sehr ich mit dem Rettungsversuch von Dux sympathisiere, so meine ich doch, dass wir uns insoweit mit einer Philosophie des Als-Ob begnügen müssen und können.
Die weitere Grundsatzkritik ist in dem Sinne ideologisch, als sie erklärt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Insbesondere der Vorwurf der Rechtfertigung des status quo ist noch gegen jede empirische Sozialforschung erhoben worden. Triftig ist nur eine sachlich-inhaltliche Kritik, die geltend macht, dass die Soziobiologie eine falsche Evolutionstheorie zugrunde legt oder dass die Theorie zusammen mit der verfügbaren Empirie die behaupteten Ergebnisse nicht trägt.
Kritik an der zugrunde gelegten Evolutionstheorie kam schon aus dem Kollegenkreis von Wilson, nämlich von Richard Lewontin und Stephen Jay Gould. Ihre Kritik litt freilich darunter, dass beide die genzentrierte Soziobiologie von Wilson und Dawkins mit Überschriften wie »Biology as Social Weapon« polemisch bekämpften. Die Frage nach der »richtigen« Evolutionstheorie öffnet ein weites Feld, das ich nicht übersehe. Meine Kritik beschränkt sich daher auf die These, dass die gängige Soziobiologie, zumal in ihrer Form als Rechtsbiologie, ihre Aussagen maßlos überzieht. In diesem Sinne hatte Jay Gould die Aussagen der Soziobiologie mit den »Just So Stories« verglichen, mit denen Rudyard Kipling erklärte, wie der Leopard zu den Flecken auf seinem Fell und der Elefant zu seinem Rüssel kam. Die Soziobiologie habe nur Geschichten ohne empirische Falsifizierbarkeit erfunden. Zentrales Problem, so Gould, bleibe die biologisch ungeklärte Verbindung einzelner Gene zum Verhalten.[16]
Bei aller Skepsis gegenüber der Sozial- und Rechtsbiologie muss man mit der modernen Kognitionswissenschaft doch davon ausgehen, dass das Gehirn mit seinen neuronalen Netzwerken kein »unbeschriebenes Blatt« im Sinne einer neutralen Rechenmaschine ist. Alles andere wäre schlicht unrealistisch. Doch wie weit und wie konkret die Evolution menschlichen Kognitionsapparat vorprogrammiert hat, ist nach wie vor die große, weitgehend offene Frage. Konsens gibt es wohl darüber, dass grundsätzlich durch die »Vorprogrammierung« keine einzelne Handlung definitiv determiniert wird, ausgenommen vielleicht der Saugreflex des Säuglings. Vielmehr wird allgemein anerkannt, dass eine Besonderheit des Menschen eben darin besteht, dass sein Kognitionsapparat eine Reflexionsfähigkeit mit sich bringt, die Automatismen überspielen kann. So beteuern denn auch die Autoren, die das evolutionär geprägte Programm näher beschreiben, wie Wilson, Dawkins[17] und Pinker, dass sich aus der »Natur« nur Wahrscheinlichkeiten, jedoch kein Determinismus für die kulturelle Entwicklung insgesamt und für das Individuum ergebe. Doch die Kritiker glauben solchen Beteuerungen nicht. In manchen Juristenköpfen ist der Evolutionsgedanke so mächtig, dass er sie auf bestimmte Inhalte hin mitreißt. Deshalb habe ich versucht, mich noch einmal selbst zu vergewissern, was Sache ist.
Evolution fragt nach der Fitness von Lebewesen, dass heißt nach ihren Chancen, zu überleben und sich zu reproduzieren. Ein Lebewesen (Organismus) ist ein physisch abgegrenztes Etwas, das seine Grenze gegenüber der Umwelt über eine gewisse Zeit halten und sich während dieser Zeit reproduzieren kann. Alles hängt von der der Entstehung und Änderung, der Speicherung und dem Austausch von Information ab. Für die biologische Evolutionstheorie sind letztlich die in DNA und Chromosomen gebündelten Gene für die Speicherung und Weitergabe der Informationen maßgeblich, die das Leben ausmachen. Die Evolutionstheorie fragt, wie Umwelt und Zufall die Information variieren, selektieren und durch Replikation (Vererbung) stabilisieren.
Ein zentrales Problem für eine an Darwin orientierte Evolutionstheorie bereitet die Frage, auf welcher Ebene die natürliche Auswahl greift. Sind es die Gene, Organismen als Individuen, Gruppen von Organismen, Arten oder Ökosysteme? Da die Evolutionstheorie auf dem Axiom aufbaut, dass »Leben« durch einen endogenen Imperativ zum Selbsterhalt und zur Fortpflanzung bestimmt ist, wäre diese Einheit gewissermaßen definitionsgemäß egoistisch (selfish).[18] Der »neue Darwinismus« der Soziobiologie setzt auf Individuen und ihre Gene.
Man sollte erwarten, dass Lebewesen alle Ressourcen »egoistisch« auf ihr Überleben und ihre Fortpflanzung verwenden. Aber im Tierreich gibt es zahlreiche Beispiele von Verhaltensweisen, die auf den ersten Blick altruistisch wirken, z. B. die Sammeltätigkeit von Arbeitsbienen oder Warnrufe von Vögeln. Die Funktion altruistischer Verhaltensweisen ist daher eines der Rätsel der Evolutionstheorie. Dawkins sagt von seinem Buch:
»My purpose is to examine the biology of selfishness and altruism.«[19]
Diese Frage haben vor ihm schon andere Biologen gestellt und grundsätzlich beantwortet. Im Prinzip werden drei Erklärungen angeboten, die zeigen, dass der Altruismus evolutionär sinnvoll ist, weil er auf Umwegen der Fitness dient: Verwandtenselektion (inclusive fitness[20] oder kin selection[21]), Reziprozität[22] und ESS-Theorie[23]. Die Verwandtenselektion arbeitet mit der These der inclusive fitness. Das heißt, sie geht davon aus, dass dem Reproduktionsimperativ gedient ist, wenn Verwandte überleben und sich reproduzieren, die jedenfalls teilweise die gleichen Gene tragen. Der Reziprozitätsmechanismus besteht darin, dass ein Individuum mit kleinem Einsatz anderen zu größerem Gewinn verhelfen kann und damit die Chance erhält, seinerseits in den Genuss solchen Gewinns zu gelangen. Die ESS-Theorie besagt, dass ein Tit for Tat eine »evolutionär stabilen Strategie« darstellt, eine Strategie, die allen anderen in einer Population vorhandenen Strategien überlegen ist.
Die Tierverhaltensforschung hat viele Beobachtungen beigebracht, die den Altruismus mit einer oder mehreren dieser drei Theorien als evolutionär erfolgreich erklären können. Dazu tritt die Evolutionspsychologie auf den Plan, um diese Frage jedenfalls grundsätzlich zu bejahen.[24] Mit zahlreichen Experimenten haben Psychologen immer wieder aufgezeigt, dass Menschen nicht ausnahmslos egoistisch handeln, sondern nicht ganz selten ein altruistisches Verhalten an den Tag legen, vor allem aber, dass sie unfaire Aufteilungen regelmäßig missbilligen.[25] Mit MRT-Scans identifiziert man bestimmte Hirnareale, die aktiv werden, wenn Versuchspersonen einschlägige Fragen beantworten. So genannte maximale Altruisten sollen über ein größeres Amygdala-Volumen verfügen, und die bei altruistischen Entscheidungen aktiven Hirnregionen reagieren verstärkt auf das Peptidhormon Oxytozin.[26] Aus solchen Experimenten nährt sich die Überzeugung, dass ein gewisser Altruismus schon genetisch angelegt sei. Alles klingt plausibel oder gar logisch. Doch es handelt sich um bloß um einen schwachen Indizienbeweis, der mit Analogien und Metaphern arbeitet. Die Kausalkette zwischen dem Verhalten und den Genen bleibt offen. Die vorgefundenen Zusammenhänge lassen sich auch sozialkonstruktivistisch plausibilisieren.
Wenn Ethologen überzeugt sind, dass ein gewisser Altruismus und ein Sinn für Fairness bereits genetisch programmiert sind, dann muss doch in Erinnerung gerufen werden, dass der im Evolutionsgeschehen angelegte Altruismus stets als erklärungsbedürftige Ausnahme von dem primären Egoismus-Imperativ der Evolution angesehen wurde. Wenn schon prosoziales Verhalten genetisch pogrammiert ist, dann liegt es nahe, beinahe mit einem Erst-recht-Schluss, auch a-soziale Verhaltensweisen wie Aggressionen und Territorialverhalten, einen In-Group-Mechanismus und allgemeiner Ethnozentrismus auf die Gene zurückzuführen. In der Tat können Psychologen solche Verhaltensweisen ähnlich belegen wie altruistisches Verhalten. Wenn aber sowohl Egoismus als auch Altruismus eine biologische Basis haben, wie sollen diese widersprüchlichen Anlagen konkrete Handlungen programmieren?
Die biologische Evolutionstheorie endet dort, wo Eigenschaften und Fähigkeiten nicht über die Gene weitergegeben, sondern von den Individuen gelernt werden. Aber natürlich lernt nicht jedes Individuum neu, so dass die Frage auftaucht, wie die Lerninhalte tradiert werden. Die Antwort bereitete der Entomologe Alfred E. Emerson vor, indem er auf Symbole als funktionale Äquivalente der Gene verwies:
»The higher mammals can learn a remarkably wide variety of things. I knew a dog that would respond to over one hundred words and phrases purely by sound. Higher mammals certainly can do a lot of learning. What they do not do is to symbolize their signals in such a fashion as to pass learning on to the next generation or to another individual directly. In other words, what they pass on is through the germ plasm rather than through symbolization. This gives rise to the marked difference between animals and humans in cultural evolution—the evolution of accumulated symbolic systems and communication systems.«[27]
Kultur besteht also aus Lerninhalten, die in irgendeiner Weise symbolisch gespeichert sind. Symbole sind mithin das kulturelle Analogon zu den Genen.
Damit stellt sich die weitere Frage, ob die Gesetze der Evolution auch für die Entwicklung der Kultur gelten. Davon geht man heute grundsätzlich aus.[28] Es handelt sich um eine multidisziplinäre Evolutionstheorie, die besagt, dass in allen Realitätsbereichen »blind-variation-and-selective-retention« wirksam sind, dass aber die Möglichkeit sach- und fachspezifischer Besonderheiten besteht. Es wird also akzeptiert, dass auch die Entwicklung der Kultur im Dreischritt von Variation, Selektion und Stabilisierung erfolgt. Allerdings ist dabei wohl nicht nur der Zufall am Werk, sondern ebenso menschliche Kreativität und Wahlhandlungen, die in Zustimmung und Ablehnung münden. Auch Niklas Luhmann hat bekanntlich diesen Dreischritt zur Grundlage seiner Evolutionstheorie gemacht.[29] »Natürlich« verzichtet Luhmann darauf, die Evolution an den Genen fest zu machen. Er setzt dafür ganz auf Kommunikation. Stichweh findet Luhmanns
»originären Beitrag … darin …, dass er Evolutionstheorie als Konflikttheorie entwirft. Es ist für ihn die Möglichkeit, ›nein‹ zu sagen, auf eine Erwartung mit der Negation dieser Erwartung zu reagieren, die die Dynamik soziokultureller Evolution freisetzt.«[30]
Auf allen Ebenen wird die Spieltheorie ins Spiel gebracht. Trivers hatte schon 1971 die Gene auf Reziprozität getrimmt[31]. 1973 entwickelten John Maynard Smith und George R. Price das Konzept einer »evolutionär stabilen Strategie«, einer Strategie, die allen anderen in einer Population vorhandenen Strategien überlegen ist.[32] Der Mathematiker Ken Binmore hat sich in zwei dicken Bänden darum bemüht, die Idee einer Verhandlung unter dem Schleier des Unwissens von John Rawls in die Spieltheorie zu übersetzen.[33] Eine zusammenfassende Darstellung, die sich an ein nicht mathematisch vorgebildetes Publikum wendet, ist 2005 unter dem Titel »Natural Justice« erschienen.[34] Wir erfahren, dass reziproker Altruismus, das heißt Altruismus in Erwartung einer Gegenleistung, ein evolutionär stabiler Mechanismus ist, auf den sich ein fairer Gesellschaftsvertrag bauen lässt. Was Binmore über Reziprozität, Fairness und Gleichheit schreibt, ist höchst plausibel, endet aber genau in den abstrakten Formeln der Moralphilosophie, die er durch exakte Wissenschaft ersetzen möchte. Vor allem aber: Auch der Mathematiker kommt nicht ohne die Gene aus:
»So how did our unique style of cooperation evolve? Because relatives share genes.« (2005 S. 8). »We must look at the deep structure of human social contract written into our genes.« (2005 S. 14).
Freilich dauert es sehr lange, bis der Gen-Pool sich neuen Herausforderungen anpasst (2005 S. 157). Dass sich die kulturelle Evolution mit Hilfe der Spieltheorie erklären lässt, leuchtet ein. Aber wie die Gene das Spielen gelernt haben sollen, bleibt dem Laien verborgen. Aber auch ein Experte wie Luigino Bruni verortet die evolutionäre Spieltheorie ganz in der kulturellen Evolution. Die evolutionäre Bedeutung spieltheoretisch erfolgreicher Strategien soll darin liegen, dass sie nicht von Rationalität und Maximierungsverhalten abhängt, sondern allein von Nachahmung, die man sich analog zur biologischen Reproduktion nach Dawkins Modell der Memetik vorstellen soll.[35]
Teil II folgt hier.
[1] Benno Heussen, Die Ur-Grammatik des Rechts. Auf der Suche nach den biologisch-psychologischen Wurzeln des Rechts, RphZ 4, 2019, 294-322.
[2] KZfSS 57, 2005, 523-542.
[3] Heiner Rindermann, Evolutionäre Psychologie im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Ethik, Journal für Psychologie 11, 2003, 331–367, S. 359. Rindermann ist später in politische Kontroversen geraten, zunächst, als er 2010 in der FAZ dem umstrittenen Autor Thilo Sarrazin bescheingte, dessen »Thesen seien ›im Großen und Ganzen mit dem Kenntnisstand der modernen psychologischen Forschung vereinbar›‹ « (Andreas Kemper, Sarrazins deutschsprachige Quellen, in: Michael Haller/Martin Niggeschmidt (Hg.), Der Mythos vom Niedergang der Intelligenz, 2012, 49–67), später durch einen Artikel über Immigranten als »Ingenieure auf Realschulniveau« im Focus-Magazin vom 17. 10. 2015. Dazu lesenwert ein ausführliches Hintergrundgespräch.
[4] Patrick Riordan, Attraktivität und Partnerschaft Wie tragfähig sind evolutionäre Überlegungen zu partnerschaftlichen Beziehungen?, München 2016. Online verfügbar unter https://edoc.ub.uni-muenchen.de/19213/1/Riordan_Patrick.pdf.
[5] Russell K. Schutt/Jonathan H. Turner, Biology and American Sociology, Part I: The Rise of Evolutionary Thinking, its Rejection, and Potential Resurrection, The American Sociologist 50, 2019, 356–377.
[6] Jonathan H.Turner/Russell K. Schutt/Matcheri S. Keshavan, Biology and American Sociology, Part II: Developing a Unique Evolutionary Sociology, The American Sociologist 51, 2020, 470–505.
[7] Z. B. Rudolf Stichweh, Die soziokulturelle Evolution menschlicher Gesellschaften. Zur Komplementarität von Differenzierungs- und Evolutionstheorie, Historische Zeitschrift 2023, im Druck.
[8] Z. B. Sebastian Schnettler, Evolutionäre Soziologie, Soziologische Revue 39, 2016, 507–536.
[9] Aus der einschlägigen Literatur: Richard D. Alexander, The Biology of Moral Systems, 1987; John H. Beckstrom, Sociobiology and the Law: The Biology of Altruism in the Courtroom of the Future, 1985; Wolfgang Fikentscher/Michael T. McGuire, A Four-Function Theory of Biology for Law, RTh 25, 1994, 1-20; Edwin Scott Fruehwald, Law and Human Behavior, A Study in Behavioral Biology, Neuroscience, and the Law, 2011; ders., An Introduction to Behavioral Biology for Legal Scholars, 2010/2014, SSRN 1627363; Margaret Gruter, Die Bedeutung der Verhaltensforschung für die Rechtswissenschaft, 1976; dies./Manfred Rehbinder (Hg.), Der Beitrag der Biologie zu Fragen von Recht und Ethik, 1983; Roger D. Masters; The Ethological Basis of Trust, Property and Competition: An Evolutionary Approach to Comparative Legal Culture, Rechtstheorie 23, 1992, 407-427; ders./Margaret Gruter (Hg.), The Sense of Justice: Biological Foundations of Law, 1992; Werner Schurig, Überlegungen zum Einfluss biosoziologischer Strukturen auf das Rechtsverhalten, 1983; Anne C. Thaeder, Die soziobiologische Erklärung der menschlichen Natur bei E. O. Wilson, in: Anne C. Thaeder (Hg.), Geistwesen oder Gentransporter, 2018, 91-181; Eckart Voland, Soziobiologie, 4. Aufl. 2013; ders., Die Natur des Menschen. Grundkurs Soziobiologie, 2007; ders., Wir erkennen uns als den anderen ähnlich, Deutsche Zf Philosophie 55, 2007, 739-749; Wolfgang Wickler/Wolfgang Fikentscher, System und Außenanbindung epigenetischer Verhaltenssteuerung, RTh 30, 1999, 69-77. Kritisch: Erhard Blankenburg, Die Rechtsbiologie – Renaissance des Naturrechts auf verhaltenswissenschaftlicher Grundlage?, Zeitschrift für Rechtssoziologie 6, 1985, 135-140; Brian Leiter/Michael Weisberg, Why Evolutionary Biology Is (so Far) Irrelevant to Law, 2007, SSRN 892881; Hubert Rottleuthner, Argumentation und Korrelation. Zur Soziologie und Neurobiologie richterlichen Handelns, FS Thomas Raiser, 2005, 579-598.
[10] Darüber berichtet Ullica Segerstrale, Defenders of the Truth. The Battle for Science in the Sociobiology Debate and Beyond, 2000. Aus demselben Jahr stammt die Dissertation von Jeremy Freese, What Should Sociology Do About Darwin? Evaluating Some Potential Contributions of Sociobiology and Evolutionary Psychology to Sociology, auf die Riordan (wie Fn. 4) vielfach Bezug nimmt. Von Freese auch: Genetics and the Social Science Explanation of Individual Outcomes, American Journal of Sociology 114, 2008, Supplement 1-35, sowie The Limits of Evolutionary Psychology and the Open-endedness of Social Possibility, Sociologica 2, 2006, 1-12.. Die jüngste materialreiche und lesenswerte Stellungnahme, die ich gefunden habe, stammt von Anja Maria Steinsland Ariansen: »Quiet is the New Loud«: The Biosociology Debate’s Absent Voices, The American Sociologist 52, 2021, 477–504.
[11] Ich zitiere nach der 2. Auflage der deutschen Ausgabe von 2018.
[12] Z. B. Giordana Grossi/Suzanne Kelly/Alison Nash/Gowri Parameswaran, Challenging Dangerous Ideas: A Multi-Disciplinary Critique of Evolutionary Psychology, Dialectical Anthropology 38, 2014, 281-285)
[13] Fabian Deus/Anna-Lena Dießelmann/Luisa Fischer/Clemens Knobloch, Einleitung der Herausgeber, in: dies. (Hg.), Die Kultur des Neoevolutionismus. Zur diskursiven Renaturalisierung von Mensch und Gesellschaft, 9-43, S. 15.
[14] Edward O. Wilson, Die Einheit des Wissens, 2000 [Consilience. The Unity of Knowledge, 1999].
[15] Günter Dux, Die Evolution der humanen Lebensform als geistige Lebensform, 2017.
[16] Stephen Jay Gould, Sociobiology: The Art of Storytelling, New Scientist 1976, 530-533.
[17] Richard Dawkins, The Selfish Gene [1976], zitiert nach der Jubiläumsausgabe 2016, S. XVI: »One of the dominant messages of The Selfish Gene (reinforced by the title essay of A Devil’s Chaplain) is that we should not derive our values from Darwinism, unless it is with a negative sign. Our brains have evolved to the point where we are capable of rebelling against our selfish genes.«
[18] Dawkins S. VIIIf.
[19] Dawkins S. 2.
[20] William D. Hamilton, The Genetical Evolution of Social Behaviour, Journal of Theoretical Biology 7, 1964, 1-16 (Teil I), 17-52 (Teil II). Dazu als kurze aktuelle Würdigung: Geoff Wild, Pillars of Biology: »The Genetical Evolution of Social Behaviour, I and II«, Applied Mathematics Publications 7, 2023, https://ir.lib.uwo.ca/apmathspub/7.
[21] Den Begriff hat wohl zuerst John Maynard Smith ins Spiel gebracht: Kin Selection and Group Selection, Nature 201, 1964, 1145-1147. Hamilton sprach zunächst von inclusive fitness.
[22] Robert L. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, The Quarterly Review of Biology 46, 1971, 35-57.
[23] Nachweise in Fn. 32.
[24] David M. Buss. Von Buss stammt Die »Evolutionary Psychology. The New Science of the Mind«, 1999, 6. Aufl. 2019; Linda R. Caporael, Evolutionary Psychology: Toward a Unifying Theory and a Hybrid Science, Annual Review of Psychology 52, 2001, 607–628; Joseph Henrich/Michael Muthukrishna, The Origins and Psychology of Human Cooperation, Annual Review of Psychology 72, 2021, 207–240.
[25] Detlef Fetchenhauer/Hans-Werner Bierhoff, Altruismus aus evolutionstheoretischer Perspektive, Zeitschrift für Sozialpsychologie 35, 2004, 131–141.
[26] R. Hurlemann/N. Marsh, Neue Einblicke in die Psychobiologie altruistischer Entscheidungen, Der Nervenarzt 8, 2016, 1131–1135.
[27] Alfred E. Emerson, Homeostasis and Comparison of Systems, in: Roy R. Grinker (Hg.), Toward a Unified Theory of Behavior, 1956, 147-154, S. 151.
[28] Diese Auffassung stützt sich vor allem auf da Werk des amerikanischen Sozialpsychologen und Methodologen Donald T. Campbell (1916-1996). Die Diskussion nahm ihren Ausgang von Campbells Artikel »On the Conflicts Between Biological and Social Evolution and Between Psychology and Moral Tradition« (American Psychologist 30, 1975, 1103-1126; näher Franz M. Wuketits, The Philosophy of Donald T. Campbell: A Short Review and Critical Appraisal, Biology and Philosophy 16, 2001, 171–188).
[29] Für das Recht hatte Niklas Luhmann schon relativ früh eine Evolutionstheorie entworfen, die zentrale Begriffe der biologischen Evolutionstheorie – Variation, Selektion und Stabilisierung – übernahm (Evolution des Rechts, Rechtstheorie 1, 1970, 3-22 = Ausdifferenzierung des Rechts, 1981, 11-34; Rechtssoziologie Bd. 1, 1972, S. 132ff. Mit der Umstellung auf die autopoietische Systemtheorie kam Luhmann der Biologie noch ein Stück näher, denn die Systeme wurden »lebendig« und ihre Evolution nun zum Herzstück seiner großen Bücher (RdG und GdG). Im »Recht der Gesellschaft« von 1995 handelt das ganze 6. Kapitel (S. 239-296) von der »Evolution des Rechts«. Darin wird der Evolutionsbegriff »in Anlehnung an die Theorie Darwins« benutzt. In der »Gesellschaft der Gesellschaft« (1997) trägt das umfangreiche Kapitel 3 (181 Seiten) die Überschrift »Evolution«.
Auch andere Juristen, die sich auf die autopoietische Systemtheorie stützen, lehnen sich für die Entwicklung des Rechts nur an die biologische Theorie an, so in erster Linie Fögen und Teubner, Amstutz und Vesting. Christoph Henke (Über die Evolution des Rechts, 2010), der sich der Evolutionstheorie ohne die Brille der Systemtheorie nähert, distanziert sich ausdrücklich von einer Biologie genetischer Vererbung, nutzt aber gleichfalls das Schema von Variation, Selektion und Stabilisierung, um die Rechtsentwicklung analog zur biologischen Theorie zu erklären.
[30] Rudolf Stichweh, Die soziokulturelle Evolution menschlicher Gesellschaften. Zur Komplementarität von Differenzierungs- und Evolutionstheorie, Historische Zeitschrift 2023, im Druck.
[31] Robert L. Trivers, The Evolution of Reciprocal Altruism, The Quarterly Review of Biology 46, 1971, 35-57.
[32] John. Maynard Smith/G. R. Price, The Logic of Animal Conflict, Nature 1973, 15–18. Maynard Smith hat das Thema intensiv weiter verfolgt: Evolution and the Theory of Games: In situations characterized by conflict of interest, the best strategy to adopt depends on what others are doing, American Scientist. 64, 1976, 41-45; Evolution and the Theory of Games, 1982; Evolutionary Genetics. 2. Aufl. 1988; John Maynard Smith/Eörs Szathmáry, Evolution. Prozesse, Mechanismen, Modelle, 1996. Dagegen platziert Robert Axelrod sein berühmtes Tit-for Tat nicht in den Genen, sondern als Strategie egoistischer Akteure: Robert Axelrod, The Emergence of Cooperation Among Egoists, American Review of Political Science 75, 1981, 306–318; ders., The Evolution of Cooperation, 1984; dt. Die Evolution der Kooperation, 2000.
[33] Game Theory and the Social Contract I: Playing Fair, 1984, Bd. II: Just Playing, 1988.
[34] Beiträge zu einem »Symposium on Kenneth Binmore’s Natural Justice« findet man in Heft 1 der Zeitschrift »Analyse & Kritik« 28, 2006;Rezensionen: Giacomo Sillari, Economics and Philosophy 24, 2008, 287-295, Achim Kemmerling, PVS 48, 2007, 773-775; Karl Widerquist, Utilitas 21, 2009, 529-532.)
[35] Luigino Bruni, Reziprozität, 2020, S 126ff.
Ähnliche Themen