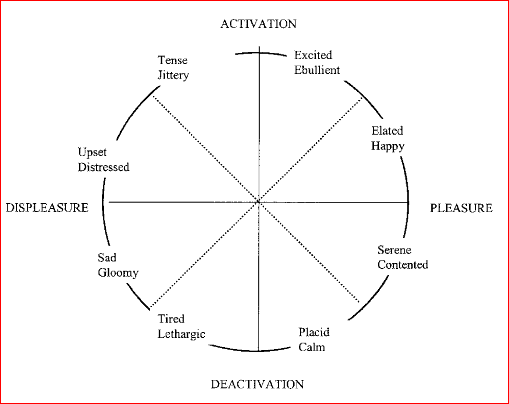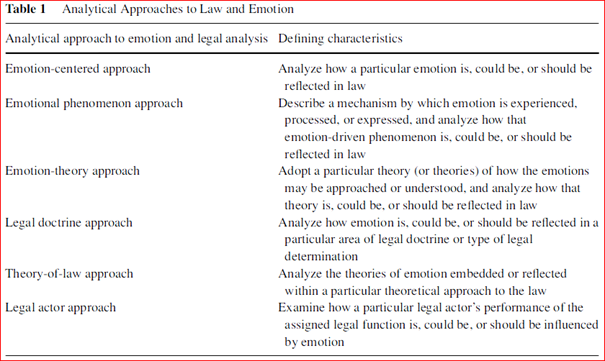Den psychischen Prozess der Emotionen hat niemand so handfest und einleuchtend dargestellt wie der niederländische Psychologe Nico H. Frijda[1]. Ich lese Frijdas »Gesetze der Emotionen« als Fortsetzung der Prospect-Theorie über kognitive Täuschungen und Heuristiken von Tversky und Kahnemann – und wundere mich, dass Frijda in den Lehrbüchern zwar als Vertreter der Bewertungstheorie angeführt wird, seine laws of emotions dort aber nicht gewürdigt werden.[2] Da macht auch Jon Elster keine Ausnahme, wiewohl er seinen Literaturhinweisen den Satz voranstellt, das beste Buch über Emotionen sei N. Frijda, The Emotions (Cambridge University Press, 1986). Das ermutigt mich, Elsters Kapitel über Emotionen wiederum als Fortsetzung der Laws of Emotions zu lesen.
Die Prospect-Theorie entstand 1979 als eine psychologische Korrektur der Rational-Choice-Theorie der Ökonomen, der Theorie, nach der Menschen ihre Entscheidungen im Hinblick auf den erwarteten Nutzen treffen. Kahneman und Tversky zeigten, wie die Menschen bei solchen Entscheidungen zu typischen Fehlannahmen über den erwarteten Nutzen kommen. Es gibt zwar Überschneidungen zwischen Frijdas »Gesetzen« und der Prospekt-Theorie. Beide kreisen um einen Utility-Aspekt. Frijdas »Gesetze der Emotionen« fassen diesen Aspekt aber weiter als in der Ökonomie üblich, nämlich als concerns. Das Law of Concern besagt:
»Every emotion hides a concern, that is, a more or less enduring disposition to prefer particular states of the world.«[3]
»Mit ›Interesse‹ ist jedes wichtige Ziel, Bedürfnis oder Wunsch gemeint. Der Begriff kann allgemein aufgefaßt werden als die Disposition, einen bestimmten Zustand der Welt oder der eigenen Person zu bevorzugen. Interesse ist das, was Ereignissen ihre emotionale Bedeutung gibt.«[4]
In der deutschen Fassung wird concern also mit »Interesse« übersetzt. Mit scheint »Betroffenheit« angemessener.
Die Prospect-Theorie befasst sich primär mit kognitiven Verzerrungen von ökonomisch relevanten Entscheidungen unter Wahrscheinlichkeitsannahmen. Frijdas »Gesetze der Emotionen« sehen Verhalten nicht durch Zweck-Mittel-Annahmen über die Zielerreichung, sondern eben durch Emotionen gelenkt. Die Prospect-Theorie ist eine Entscheidungstheorie. Sie geht davon aus, dass Annahmen über die Erreichbarkeit von Zielen die Handlungsbereitschaft steuern. Frijdas »Gesetze« erklären viel breiter Verhalten aus der Wahrnehmung von emotional relevanten Situationen. Frijda versteht unter einer Emotion ein »Änderung der Handlungsbereitschaft«[5]. Seine »Gesetze« beschreiben, wie emotional bedeutsame Ereignisse über Gefühle auf die Handlungsbereitschaft der Person einwirken. Allerdings sind auch für die Erwartungstheorie Gefühle relevant. Eine zentrale Annahme der Erwartungstheorie geht dahin, dass loss aversion ein zentrales Motiv für Entscheidungen bildet, denn Verluste haben negative Gefühle zur Folge. Kahneman und Tversky machen geltend, dass Menschen das negative Gefühl des Bedauerns (regret) vermeiden wollen, dass aufkommt, wenn sie erkennen müssen, dass sie erkennen müssen, dass ihr Handeln verlustreich war.
Es macht nicht viel Sinn, die laws of emotion hier vollständiger zu referieren. Frijdas Darstellung von 1988 ist so knapp und anschaulich, dass darauf verwiesen werden darf. Daher will ich die Gesetze nur aufzählen. Die ersten sechs dieser »Gesetze« gelten der Auslösung von Gefühlen. Weitere sechs handeln von der Dauer, der Modularität und der Regulierung von Emotionen.
- The law of situational meaning: Emotions arise in response to the meaning structures of given situations; different emotions arise in response to different meaning structures.
- The law of concern: Emotions arise in response to events that are important to the individual’s goals, motives, or concerns.
- The law of apparent reality. Emotions are elicited by events appraised as real, and their intensity corresponds to the degree to which this is the case.
- The law of change: Emotions are elicited not so much by the presence of favorable or unfavorable conditions, but by actual or expected changes in favorable or unfavorable conditions.
- The law of habituation: Continued pleasures wear off; continued hardships lose their poignancy.
- The law of comparative feeling: The intensity of emotion depends on the relationship between an event and some frame of reference against which the event is evaluated.
- The law of hedonic asymmetry (the law of asymmetrical adaptation to pleasure or pain): Pleasure is always contingent upon change and disappears with continuous satisfaction. Pain may persist under persisting adverse conditions.
- The law of conservation of emotional momentum: Emotional events retain their power to elicit emotions indefinitely, unless counteracted by repetitive exposures that permit extinction or habituation, to the extent that these are possible.
- The law of closure: Emotions tend to be closed to judgments of relativity of impact and to the requirements of goals other than their own.
- The law of care for consequence: Every emotional impulse elicits a secondary impulse that tends to modify it in view of its possible consequences.
- The law of the lightest load: Whenever a situation can be viewed in alternative ways, a tendency exists to view it in a way that minimizes negative emotional load.
- The law of the greatest gain: Whenever a situation can be viewed in alternative ways, a tendency exists to view it in a way that maximizes emotional gain.
Sicher müssen diese Gesetze zusammen mit Frijdas Beispielen und Erläuterungen gelesen werden. Doch ich finde sie schon in der nackten Aufzählung eindrucksvoll.
Frijda sagt von seinen Gesetzen,
»I am discussing what are primarily empirical regularities. These regularities – or putative regularities – are, however, assumed to rest on underlying causal mechanisms that generate them«.[6]
Der empirische Gehalt wird allerdings bestritten. Jan Smendslund meint, sie seien nicht empirisch. Sie zeigten keine Beziehungen zwischen unabhängigen Variablen, sondern seien aus plausiblen Definitionen und aus Axiomen (presuppositions) abgeleitet, die man schwerlich verneinen könne, und damit seien sie letztlich tautologisch.[7] Klar, dass Frijda ihm widerspricht.[8] Smedslund hat sicher einen Punkt insofern, als eine Neigung besteht, Emotionen so zu definieren, dass implizit schon Theorien der Entstehung und Wirkung vorweggenommen werden. Zirkulär erscheint Frijdas Definition der Emotion als Reaktion auf die spezifische Bedeutung einer Situation.
»Emotions arise in response to the meaning structures of given situations; different emotions arise in response to different meaning structures.«[9]
Diese Zirkularität wiederholt sich in dem law of concern, das besagt, dass Emotionalität aus Betroffenheit entsteht. Umgekehrt gilt aber auch, dass sich aus Emotionalität auf Betroffenheit schließen lässt. Dieser Zirkel lässt sich auflösen, wenn man die Emotion nicht als fertiges Dispositiv betrachtet, sondern mit den gängigen Emotionstheorien die Genese des Emotionsdispositivs durch Anlage und Lernvorgänge einbezieht. Eine Emotion kann auf einer Erfahrungsbasis beruhen. Sie Sie setzt aber nicht in jedem Fall frühere Kognitionen voraus: »A rose smells good because it smells good«[10]. Aber auch hier gilt wohl: Jede Reaktion, die als emotional qualifiziert wird, nimmt ihren Ausgang von einem aktuellen Emotionsdispositiv, das aber wiederum durch jedes Erlebnis, und sei es auch nur infinitesimal, verändert wird.
Mein Problem mit den »Gesetzen« besteht darin, dass Frijda kaum zwischen Erstreaktion und »Gefühlen als Bewusstsein einer Handlungsbereitschaft«[11] unterscheidet, sondern erklärt, das Wort »kognitiv« impliziere kein Bewusstsein[12]. Immerhin hatte er 1988 erwähnt, dass Emotionen, die (zunächst nur) die Handlungsbereitschaft umsteuern, gewöhnlich basic oder primary genannt würden, und dass nur diese Basisemotionen spezifische Formen der Handlungsbereitschaft bewirken.[13] Diese Lücke hat Frijda später durch die Annahme von ur-emotions zu füllen versucht.[14] Die Uremotionen sollen abstrakter sein als die geläufigen Basisemotionen. Ganz verstanden habe ich den Unterschied nicht, zumal Frijda allgemein auf eine biologische Basis und speziell auf die Ähnlichkeit zu Panksepps Emotionstheorie verweist.
»Ur-emotions, we propose, reflect a limited number of modes of relating to other people, objects, or circumstances.« (S. 406)… »The term ur-emotion can therefore suggest both an underlying structure and an evolutionary, biologically based source.« (S. 407)«
Über die biologische Basis der ur-emotions erfahren wir weiter nichts. Es soll sich um Formen von Handlungsbereitschaft noch ohne Gegenstand handeln, immerhin 18 an der Zahl, für die Universalität in Anspruch genommen wird. Sie werden jeweils durch die Bewertung von Auslösern (by events appraised; S. 410) aktiviert. So bleibt das Rätsel der unbewussten Erstreaktion, dass sich wohl nur über eine Verbindung von biologischer Prädisposition mit individuellem und sozialem Lernen auslöst. Nimmt man eine solche Prädisposition aber als gegeben hin, dann erweisen sich Frijdas »Gesetze« als gehaltvoll, so gehaltvoll, dass sie, wie gesagt, als Fortsetzung und Ergänzung der Prospect-Theorie von Tversky und Kahnemann gelten können: Frijda beschreibt keine »kognitiven«, sondern emotionale Heuristiken, die nicht immer zu rationalen Entscheidungen führen, sondern auch zu emotionalen Täuschungen werden können.
Wie gesagt, Jon Elsters Kapitel über Emotionen[15] habe ich wiederum als Fortsetzung von Frijdas Laws of Emotions gelesen. Es bildet zugleich eine Zusammenfassung früherer Arbeiten Elsters, die die Emotionspsychologie für eine Rezeption in Philosophie, Soziologie und Rechtswissenschaft[16] aufarbeiten – und ist insoweit bis heute unübertroffen.[17]
Das Vorgehen Elsters hat Christoph Henning besser erklärt, als ich es kann. Hier ist nur zu sagen, dass Elster nicht unmittelbar Psychologie betreibt oder referiert, sondern – selbstverständlich informiert durch die Fachpsychologie – den Spuren nachgeht, die die Reflexion über Emotionen in der Literatur hinterlassen hat. So entsteht eine Art »historischer Psychologie«, die, wenn man ihre Ergebnisse ansieht, die Fachpsychologie erst praxistauglich machen.
Der Artikel in Legal Theory 1997 nimmt ein Kapitel aus dem Buch von 1998 vorweg. Da geht es darum, dass man sich in der diskursiven Auseinandersetzung mit anderen mindestens den Anschein der Objektivität oder Unparteilichkeit geben möchte mit der Folge, dass emotionale Handlungsantriebe und Interessen als rational dargestellt werden, dass man aber auch umgekehrt Emotionen und Interessen hervorkehren kann, um seine Wünsche als rational erscheinen zu lassen. In dieser Kürze klingt das grob und vielleicht auch banal. Wenn man Elsters ausführliche Darstellung nachliest, fragt man sich, wie weit die Argumentationstheorie in die Wolken schönen Schein abgehoben hat. Ich beziehe mich im Folgenden allein auf Elsters den Text von 2015, der sich explizit mit Emotionen befasst.
Zunächst erklärt uns Elster, wie schwierig es ist, das Phänomen »Emotionen« in den Griff zu bekommen:
»There is no agreed-upon definition of what counts as an emotion, that is, no agreed-upon list of sufficient and necessary conditions. There is not even an agreed-upon list of necessary conditions. Although I shall discuss a large number of common features of the states that we understand, preanalytically, as emotions, there are counterexamples to all of them. For any such feature, that is, there are some emotions or emotional occurrences in which it is lacking. We may think that action tendencies are crucial to emotion, but the aesthetic emotions provide a counterexample. We may think that a ›short half-life‹, that is, a tendency to decay quickly, is an essential feature of emotion, but in some instances unrequited romantic love (such as that of Cyrano de Bergerac) or the passionate desire for revenge can persist for years or decades. We may think that emotions are triggered by beliefs, but how do we then explain that people can get emotionally upset by reading stories or watching movies that are clearly fictitious? Many other examples could be given of allegedly universal features that turn out to be lacking in some cases.« (S. 138)
Die Phänomene, die als Emotion angesehen werden, seien so unterschiedlich, dass man sie schwerlich als natürlich (natural kind) begreifen könne (S. 139). Aber diese Grundsatzfrage könne offenbleiben. Fest stehe jedenfalls, die meisten Emotionen würden durch Überzeugungen (beliefs) ausgelöst. Manche wie Furcht und Abscheu entstünden jedoch durch bloße Wahrnehmung, slo vor das Bewusstsein beteiligt sei.
»Natural selection might well have hardwired a tendency to ›shoot first; ask later›‹.« S. 141)
Solche Automatismen teile der Mensch mit Tieren. Einzigartig für Menschen einen dagegen die nachträglichen Rechtfertigungen. Damit bahnt sich schon der Übergang zu solchen Emotionen an, die für das soziale Zusammenleben Bedeutung haben. Elster spricht von bewertenden Emotionen (evaluative emotions, S. 142) und lässt offen, ob die basic oder non-basic sind:
Shame is triggered by another person’s negative belief about the agent’s character.
- Contempt and hatred are triggered by the agent’s negative beliefs about another’s character. Contempt is induced by the thought that another is inferior, hatred by the thought that he is evil. Hitler thought Jews were evil, and Slavs inferior.
- Guilt is triggered by a negative belief about one’s own action.
- Anger is triggered by a negative belief about another’s action toward oneself.
- Cartesian indignation is triggered by a negative belief about another’s action toward a third party.
- Pridefulness is triggered by a positive belief about one’s own character.
- Liking is triggered by a positive belief about another’s character.
- Pride is triggered by a positive belief about one’s own action.
- Gratitude is triggered by a positive belief about another’s action toward oneself.
- Admiration is triggered by a positive belief about another’s action toward a third party.
Dann folgen S. 143 sechs Emotionen, die sich positiv oder negativ auf den Status anderer beziehen:
- Envy is caused by the deserved good of someone else.
- Aristotelian indignation is caused by the undeserved good of someone else. The closely related emotion of resentment is caused by the reversal of a prestige hierarchy, when a formerly inferior group or individual emerges as dominant.
- Sympathy is caused by the deserved good of someone else.
- Pity is caused by the undeserved bad of someone else.
- Malice is caused by the undeserved bad of someone else.
- Gloating is caused by the deserved bad of someone else.
[Mir fehlt hier eine Gruppe von Emotionen, die sich unmittelbar auf die Wahrnehmung anderer Personen bezieht. Es geht dabei um den »ersten Eindruck« wie er etwa bei Bewerbungsgesprächen und anderen »unfreiwilligen« Begegnungen, wie sie auch bei Gericht massenhaft vorkommen (Primacy Effekt + Halo-Effekt, Attraktivitäts-Halo, What is beautiful is good-Effekt). Über diese Gruppe erfährt man auch sonst in der Emotionspsychologie wenig Grundsätzliches. Die Effekte als solche sind zwar in vielen empirischen Studien nachgewiesen. Ich habe aber keine Verknüpfung mit einer Basis-Emotion gefunden. Das liegt vielleicht daran, dass als Basisemotion eine solche in Betracht kommt, die biologisch verankert ist und eine Handlungsbereitschaft in Richtung auf Sexualität und Partnerwahl stimuliert. Hier könnten die vom kulturalistischen Konstruktivismus verordneten Scheuklappen die Sicht verstellen.]
Interessant ist sodann der Abschnitt über »Emotion and Action« (S. 146ff), weil es hier um Gefühle geht, die durch Normverletzungen ausgelöst werden.
»The emotions of anger, guilt, contempt, and shame have close relations to moral and social norms. Norm violators may suffer guilt or shame, whereas those who observe the violation feel anger or contempt.« (S. 146)
Elster unterscheidet hier also zwischen der Gefühlsreaktion auf die Verletzung moralischer und sozialer Normen. Beim Verstoß gegen soziale Normen empfinden der Akteur Scham und der Beobachter Verachtung (contempt). Bei einem Moralverstoß empfindet der Akteur Schuld und der Beobachter Entrüstung (anger). Diese Gefühle lösen dann typische Handlungsbereitschaften aus. Entrüstung (anger) verlangt nach Rache (revenge), Scham nach Selbstbestrafung, die bis zum Selbstmord gehen kann. Man kann diese Passage als eine Bestätigung der alten Gefühlstheorie von Eugen Ehrlich lesen.
In einem Abschnitt über Emotionen und Politik erfahren wir, dass politisches Handeln fast nur von negativen Emotionen begleitet wird. Als positive Emotion zeige sich nur Begeisterung (enthusiasm, S. 152). Elster demonstriert sodann die Wirkung von Emotionen auf politisches Handeln am Beispiel der Aufarbeitung politischer Verbrechen nach dem 2. Weltkrieg.
Wichtig der Hinweis auf den wechselseitigen Einfluss von Emotionen und Überzeugungen (cognitions). Es geht u. a. um den hot–cold empathy gap und ein Gegenstück, den cold–hot empathy gap (S. 156). Unter dem Einfluss einer Emotion fehlt es an einer Vorstellung, wie man nüchtern rational denken würde. In Zustand emotionsfreier Nüchternheit ist schwer vorstellbar, wie Rationalität unter dem Einflus von Gefühlen zurücktreten kann.
Das Kapitel endet mit bemerkenswerten Bemerkungen über die kulturelle Relativität von Emotionen. Mit der wohl heute »h. M.« hält Elster jedenfalls einige Emotionen (happiness, surprise, fear, sadness, disgust, and anger ) für universal. Vielleicht seien aber auch andere Emotionen universal, ohne dass alle Gesellschaften dafür explizite Konzepte entwickelt hätten. So gelte romantische Liebe als eine moderne Erfindung. Vermutlich hätten Menschen aber auch früher ähnlich empfunden. Allerdings ohne das Gefühl benennen zu können. Freilich habe die Konzeptualisierung von Emotionen eine Verstärkungswirkung. Dazu zitiert Elster den französischen Moralisten La Rochefoucauld: »Some people would never have fallen in love if they had never heard of love.« (S. 157)
Und zum Schluss, für die Rechtssoziologie wichtig, sagt Elster:
»If one believes, as I do, that social norms exist in all societies, the emotions that sustain them – contempt and shame – must also be universal.«
Ob ich die Reihe über den Emotional Turn und die Rechtswissenschaft fortsetze, ist noch nicht klar. Es ist etwas dazwischengekommen. Darüber hier.
[1] Grundlegend Nico H. Frijda, The Emotions, 1986. Ich beziehe mich auf den Aufsatz »The Laws of Emotion«, The American Psychologist 43, 1988, 349–358; ähnlich: Die Gesetze der Emotionen, Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 1996, 205–221; ders., Emotion Experience and its Varieties, Emotion Review 2009, 264–271. Der Aufsatz von 1988 entspricht weitgehend dem ersten Kapitel in dem 2007 erschienenen Band »The Laws of Emotion«.
[2] Laut Google Scholar wird Frijda mit dem Titel »Laws of Emotion« 5900 Mal zitiert.
[3] 1988 S. 351.
[4] 1996 S. 210.
[5] Die Gesetze der Emotionen, Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse 1996, 205–221, S. 208.
[6] The Laws of Emotion«, The American Psychologist 43, 1988, S. 349.
[7] Jan Smedslund, Are Frijda’s »Laws of Emotion« Empirical?, Cognition and Emotion 1992, 435–456. Ein Rezensent der Monographie Frijdas von 2006 meint, Smedlunds Kritik habe dazu geührt, dass Frijdas »Gesetze« in der Wissenschaft zwar zitiert, aber nicht als empirische Gesetze akzeptiert würden (The Academy of Management Review , 32, 2007, S. 995-998, S. 995.
[8] Nico H. Frijda, The Empirical Status of the Laws of Emotion, Cognition & Emotion 1992, 467–477.
[9] 1988 S. 349.
[10] Frijda im Handbook of Emotions 2000, 63 (fehlt in der 3. Aufl. von 2008).
[11] Ebd. S. 207.
[12] Ebd. S. 218.
[13] The Laws of Emotion, The American Psychologist 43, 1988, 349–358, S. 351.
[14] Nico H. Frijda/W. Gerrod Parrott, Basic Emotions or Ur-Emotions?, Emotion Review 2011, 406–415.
[15] Jon Elster, Explaining Social Behavior, 2. Aufl. 2015, S. 158.
[16] Jon Elster, Alchemies of the Mind, 1998; ders., Alchemies of the Mind: Transmutation and Misrepresentation, Legal Theory 3, 1997, 133–176.
[17] Zur Würdigung Christoph Henning, Alchemies of the Mind: Wie Jon Elster die Gefühle in die Vernunft einholt, in Ingo Pies (Hg.), Jon Elsters Theorie rationaler Bindungen, 2008, 107–128; Annette Schnabel, Jon Elster: The Alchemies of the Mind, in Konstanze Senge u. a. (Hg.), Schlüsselwerke der Emotionssoziologie, 2022, 163–168.