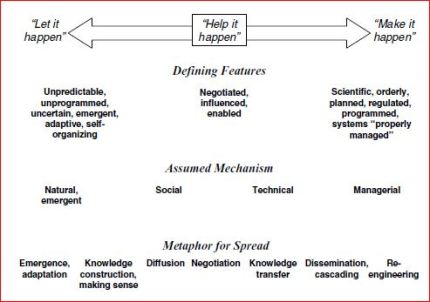Der kulturelle Code der Ethnologie ist ein ausgeprägter Konstruktivismus, und den verfolgt auch Richard Rottenburg. Er wendet sich gegen die klassische anthropologische Diffusionstheorie, die annimmt, dass Ideen und Artefakte sich aus eigener Kraft ausbreiten, bezieht sich dazu allerdings nur auf Friedrich Ratzel (1844-1904), der bei der Ethnologie in Ungnade gefallen ist, weil seine Vorstellungen über die Innovationsfähigkeit von Gesellschaften deutlich eurozentrisch, wenn nicht gar rassistisch waren. Die neuere Diffusionstheorie a là Rogers wird dagegen ignoriert. Aus ethnologischer Sicht gäbe es wohl Gründe, auch diese Version zurückzuweisen. Doch sie ändern nichts daran, dass sich die »Travelling Models« als ein Exemplar qualitativer Diffusionsforschung vereinnahmen lassen. Umso wichtiger wäre es, die soziologische Diffusionsforschung als Kontrastfolie zu nutzen.
Das gilt um so mehr, als Rottenburg der Liste diffusionsförderlicher Attribute von Rogers ein neues hinzufügt, nämlich die Annahme, dass von den unzählig vorhandenen Ideen oder Modellen nur solche zur Übernahme ausgewählt werden, die über eine gewisse »Aura« verfügen. Was die Aura betrifft, so habe ich die nähere Begründung an den in »Travelling Models« S. 17 angegebenen Stellen nicht gefunden. Nach Fn. 4 auf S. 18 handelt es sich um eine Anlehnung an Walter Benjamin:
»Following Walter Benjamin, Richard Rottenburg defines aura as the persuasive character, the vibe of a token (with Benjamin it was the vibe of a piece of art) that demonstrates originality, authenticity, uniqueness, inimitability – in short, it arrives as ‘the real thing’ and thus as distinct from a ‘poor imitation’. He maintains that aura often becomes an invisible aspect of power when it persuades or misguides others to do what they would not have done otherwise.«
Die Originalfundstelle ist nicht benannt, ohne nähere Erläuterung lässt sich damit aber wenig anfangen, und in den nachfolgenden Kapiteln von »Travelling Models« spielt der Gesichtspunkt auch keine Rolle.
Benjamins »Aura« hat längst selbst eine Aura, von der vermutlich jeder, der sie anführt, profitiert. Und der Begriff bleibt, auch wenn man noch einmal Benjamins Text nachliest, so offen, dass sich jeder seinen eigenen Reim darauf machen kann. Trotzdem scheint der Gesichtspunkt triftig zu sein. Das kann ich aber nur anekdotenhaft versichern. Ein Beispiel ist die verrückte Ice-Bucket-Challenge, die gerade über die Kontinente wanderte. Ein anderes eine Äußerung des Stuttgarter Oberbürgermeisters Kuhn im Hinblick auf das dortige Energiesparhaus B10: Fakten allein reichen nicht. »Wir brauchen ein Faszinosum«. Das Problem dabei ist, dass die Aura letztlich doch kein objektives Attribut der Sache ist, sondern ihr von der Umgebung beigelegt wird. Diese Attribuierung ist anscheinend schon da, bevor Übernehmer ins Spiel kommen, und die Übernehmer besitzen ihrerseits dafür ein Gespür.
Wichtiger ist aber, wie der Ethnologe den Gesichtspunkt anspricht, den Rogers und Greenhalgh als re-invention behandeln , nämlich als Übersetzung (translation). An einer Stelle zitiert Rottenburg kurz Benjamins Theorie der Übersetzung Bei Benjamin geht es allerdings um Textübersetzung und hier wiederum um die Übersetzung von Dichtung. Dass dabei »keine Übersetzung möglich wäre, wenn sie Ähnlichkeit mit dem Original ihrem letzten Wesen nach anstreben würde«, wer wollte das bezweifeln. Auch Juristen erleben in Zeiten der Internationalisierung immer wieder die Schwierigkeiten der Übersetzung. Dabei wird freilich auch oft übertrieben.
Die Probleme der Textübersetzung legen es nahe, den Übersetzungsbegriff als Metapher für die Übertragung von Objekten aus einer Sinnsphäre in eine andere zu verwenden, um auszudrücken, dass solche Übertragung das Objekt der Übersetzung nicht unverändert lässt. Den metaphorischen Gehalt schöpft der Begriff der kulturellen Übersetzung aus, der wohl 1994 von Homi K. Bhabha in die Welt gesetzt wurde. Rottenburgs Texte, die ich hier anführe, wurden noch vor der Ausrufung des translational turn durch Doris Bachmann-Medick (1. Aufl. 2006) geschrieben. Seither ist die »Kulturelle Übersetzung« ihrerseits zu einem travelling model geworden. Die damit verbundene Grundeinstellung, dass jede Kommunikation interpretierbar sei, war jedoch schon zuvor über alle Geistes- und Sozialwissenschaften verbreitet.
Die Übersetzungsmetapher macht Sinn, wenn man unterschiedliche kulturelle Kontexte mit Sprachen vergleicht. Sehr weit trägt sie nicht. Man kann davon ausgehen, dass adäquate Übersetzungen von einer Sprache in die andere zwar oft mühsam, aber grundsätzlich möglich sind. Aber Ethnologen interessiert weniger die adäquate Übersetzung, als vielmehr der kreative Umgang mit dem fremden Material. Deshalb wäre es sinnvoll, zwischen Übersetzung und Transformation zu unterscheiden. Das in der Diffusionsforschung verwendete Konzept der re-invention ist davon gar nicht so weit entfernt.
Wenn man bei Rottenburg liest:»
»Translation aims at the appropriation of an external thing, which is then given another function, an altered meaning and often a new shape in the new context.« (1996 S. 214)
ist der erste Eindruck, dass damit das (heute) als kulturelle Übersetzung geläufige Phänomen gemeint sei. Dazu passt, wenn es drei Sätze weiter heißt (und dort auch transmission und transformation einander gegenüber gestellt werden):
»In the case of the movement of ideas and artefacts through time and space, each actor therefore takes the ›thing‹ into his or her own hands and gives it the shape and direction that best corresponds to his/her context and intentions. In this way, we move from the trans-mission of a thing that remains the same to the trans-formation of the thing.«
Doch der Eindruck täuscht, denn ich habe drei Sätze übersprungen, die in eine andere Richtung führen, nämlich zu der »Soziologie der Übersetzung« von Michel Callon und Bruno Latour:
»The constructivistic ›sociology of translation‹ as advocated by Michel Callon and Bruno Latour (1981; Latour, 1986) offers an image which can help us to understand appropriation and contextualization processes. While the classical anthropological diffusion model (Ratzel, 1896) assumes that ideas and artefacts move through social space and across borders under their own steam, it is more accurate to imagine this process as a kind of ball game. Only if the actors catch the ball and pass it on, i. e. if they collaborate, can the game continue.« (Rottenburg 1996 S. 214f)
In der »Soziologie der Übersetzung« steckt die ganze Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT). Die hat zwar kaum in der Soziologie selbst, umso mehr aber in den sozialwissenschaftlichen Kranzfächern (Kunstwissenschaft, Medienwissenschaft, Pädagogik und nicht zuletzt Ethnologie) Anhänger gefunden. Mich interessiert sie gerade nur soweit, wie erforderlich, um die Texte der Hallenser Ethnologen zu entziffern. Auf dem Wege dahin gilt es, einige eher schräge Begriffe zu lernen wie token, Mikro- und Makroakteure, black-boxes und obligatorische Passagepunkte. Die maßgeblichen Texte von Callon und Latour, auf die ich mich dazu beziehe, sind in deutscher Übersetzung versammelt in: Andréa Belliger/David J. Krieger (Hg.), ANThology, 2006.
Latour führt die Übersetzungstheorie als Kontrast zu einem Diffusionsmodell ein. Dazu bekommt das Objekt der Diffusion einen neuen Namen, es wird zum token. Im Einleitungskapitel zum Buch »Travelling Models« (S. 3) heißt es vom Token:
»In this view, before something becomes a model worth imitating, it is an element of an ontological, epistemic, normative or material order. Only by being distinguished and disconnected from its setting this element becomes a token of this setting. A token is a thing that works like an established symbol of something, but also as replacement and evidence of thc order for which it stands.«
Und in der Fußnote dazu wird erläutert:
»A token can, for instance, be a device such as a coin bought for use with machines or for other payments where money is not handled. See also Latour (1986) for a similar use of ›token‹.«
Ungeachtet solchen Definitionsaufwands steht der Token im nachfolgenden Text aber doch nur für das travelling model, also – wie bei Latour – für den Gegenstand der Diffusion.
Latours Diffusionsmodell erklärt die Verbreitung eines Tokens aus einer ihm anfänglich innewohnenden Kraft, »die der Trägheit in der Physik ähnelt« (Die Macht der Assoziation, S. 196). »Dampfmaschinen, Elektrizität oder Computer sind solchermaßen mit Trägheit ausgestattet, dass sie außer durch die reaktionärsten Interessengruppen und Nationen kaum noch gestoppt werden können« (S. 197f). Schwierig wird das Verständnis dieses Diffusionsmodells – und anschließend der Theorie der Übersetzung – daraus, dass die klassischen Objekte der Diffusion wie Dampfmaschine usw. nur am Rande interessieren, denn im Zentrum stehen nicht »Artefakte«, sondern »Anordnungen« und »Ansprüche«, die mit Macht verbreitet werden. Das liegt daran, dass die ANT auch nicht menschliche Objekte als Akteure behandelt.
Latour erklärt den Unterschied zwischen der Sichtweise der herkömmlichen Soziologie (»soziologische Version«) und seiner eigenen Theorie (»materialistische Version«) am Beispiel einer Schusswaffe. Nach der soziologischen Version gilt: »Menschen töten Menschen, nicht Schusswaffen«, und Latour erläutert:
»Die Schusswaffe ist ein Werkzeug, ein Medium, ein neutraler Träger eines Willens. Wenn der Waffenbesitzer ein guter Mann ist, wird die Schusswaffe weise eingesetzt und nur gerecht töten. Wenn er jedoch ein Verbrecher oder Verrückter ist, dann wird ohne eine Veränderung in der Waffe selbst ein ohnehin ausgeführter Mord (einfach) effizienter ausgeführt. … die soziologische Version [macht] die Waffe zu einem neutralen Willensträger, der der Handlung nichts hinzufügt, der die Rolle eines elektrischen Leiters spielt, durch den Gutes und Böses mühelos Fließen.«
Die »materialistische Version« sagt dagegen: »Schusswaffen töten Leute«, und wiederum erläutert Latour:
»Ein unschuldiger Bürger wird ein Krimineller kraft der Waffe in seiner Hand. Die Waffe befähigt natürlich, aber sie instruiert auch, lenkt, zieht sogar am Abzug – und wer hätte nicht, mit einem Messer in der Hand, zu einer gewissen Zeit jemanden oder etwas erstechen wollen? Jedes Artefakt hat sein Skript, seinen Aufforderungscharakter. sein Potenzial, Vorbeikommende zu packen und sie dazu zu zwingen, Rollen in seiner Erzählung zu spielen.«
Was die Waffe dem Schuss hinzufügt, ist »Übersetzung« in der Form der »Vermittlung«.
»Der Mythos des neutralen Werkzeugs unter vollständiger menschlicher Kontrolle und der Mythos der autonomen Bestimmung, die kein Mensch beherrschen kann, sind symmetrisch. Aber eine dritte Möglichkeit liegt meistens näher: die Schaffung eines neuen Ziels, das keinem der Handlungsprogramme der Agenten entspricht. (Man hatte nur verletzen wollen, jedoch jetzt – mit einer Schusswaffe in der Hand – will man töten.) Ich nenne diese Unsicherheit über Ziele Übersetzung. … ›Übersetzung‹ bedeutet nicht eine Verschiebung von einem Vokabular in ein anderes. z.B. von einem französischen in ein englisches Wort, als ob die beiden Sprachen unabhängig existierten. Wie Michel Serres verwende ich ›Ubersetzung‹, um Verschiebung, Driften, Erfindung. Vermittlung, die Erschaffung eines Bindeglieds, das zuvor nicht existiert hatte und das zu einem gewissen Grad zwei Elemente oder Agenten modifiziert, auszudrücken.« ( Ebd. S. 487.)
Damit ist auch schon der Übersetzungsbegriff eingeführt, der bei Callon und Latour nicht (nur) für Sinnübertragung, sondern für die Übertragung und Konversion von Kräften steht. Als lexikalisierte Metapher bedeutet »Übersetzung« auch »Getriebe«. Im Französischen steht traduction für die sprachliche Übersetzung; translation bedeutet eher körperliche Überführung (Fahrbetrieb) und transmission vor allem Nachrichten- und Kraftübertragung. Callon und Latour haben ihren Aufsatz auf Englisch geschrieben. Im Englischen liegen translation und transmissison = Getriebe weiter auseinander. Das Nebeneinander dieser Wörter in den verschiedenen Sprachen verweist nicht nur auf Probleme der Sprachübersetzung, sondern deutet darauf hin, dass der metaphorische Gebrauch der Wörter problematisch ist. Indem Callon und Latour die Übersetzungsmetapher nicht für eine produktive Sinnübernahme (= kulturelle Übersetzung) nutzen, sondern für die Übertragung und Bündelung von Kräften, wird sie verwirrend statt hilfreich. Auch mit Hilfe der Erläuterungen von Belliger/Krieger habe ich nur verstanden, das »Übersetzung« etwas Diffuses ist. Die gezielte Verwendung nicht anschlussfähiger Begriffe durch Callon und Latour und ihre Mitstreiter ist eine wohl beabsichtigte, aber deshalb noch lange nicht akzeptable Irreführung.
Auch Rottenburg macht von der Zweitbedeutung von Übersetzung als Getriebe Gebrauch, wenn er (2002 S. 15) Flaschenzug und Fahrradkette bemüht. Aus der Fahrradkette wird später eine Übersetzungkette (2002, 224ff). Sie steht für die Aufbereitung und Weitergabe von Primärdaten des Projektträgers (Wasserwerke). Bis die Daten am Ende das »Rechenschaftszentrum« (die Entwicklungsbank) erreichen, gehen sie durch mehrere Hände mit der Folge, dass sie nicht ohne Deformation ankommmen.
Callon spricht von einem »neuen Ansatz zur Untersuchung von Machtverhältnissen: d[er] Soziologie der Übersetzung«. Dabei tritt an Stelle des (rätselhaften) anfänglichen Impulses, der kraft Trägheit fortwirkt, »die Initialkraft jener, die Macht haben« (Latour S. 198).
»Übersetzung umfasst alle Verhandlungen, Intrigen, Kalkulationen. Überredungs- und Gewaltakte, dank derer ein Akteur oder eine Macht die Autorität, für einen anderen Akteur oder eine andere Macht zu sprechen oder zu handeln, an sich nimmt oder deren Übertragung auf sich veranlasst ›Unsere Interessen sind dieselben‹, ›Tu, was ich will‹, ›Du kannst ohne mich keinen Erfolg haben‹ – immer wenn ein Akteur von ›uns‹ spricht, übersetzt er oder sie andere Akteure in einen einzigen Willen, dessen Geist und Sprecher/-in er oder sie wird. Er oder sie beginnt, für mehrere zu handeln – nicht nur für eine/-n -, wird damit stärker, wächst.« (Callon/Latour S. 76f)
Wer da wächst und stärker wird, ist ein »Makroakteur«, der sich allerdings nicht durch irgendwelche äußeren, physischen Eigenschaften von normalen »Mikroakteuren« unterscheidet, sondern nur dadurch, dass er etwas auf sich »übersetzen« kann. Der Witz dieser Machttheorie liegt wohl darin, dass wir uns Macht nicht als Vorrat vorstellen sollen, sondern als Phänomen, das erst durch eine Kette von Übersetzungshandlungen an einem Token zustande kommt. Macht hat man nicht, sondern sie wird gemacht. Sie zeigt sich unter anderem in »obligatorischen Passagepunkten« (OPP).
Die »obligatorischen Passagepunkte« sind wohl eine Erfindung von Michel Callon. Ich zitiere aus der Zusammenfassung seines Artikels »Einige Elemente einer Soziologie der Übersetzung« (dort S. 135; vgl. auch S. 147, 149f):
»Der Artikel umreißt einen neuen Ansatz zur Untersuchung von Machtverhältnissen: die Soziologie der Übersetzung. Ausgehend [u. a. ] von der Vermeidung aller a-priori-Unterscheidungen zwischen dem Natürlichen und dem Sozialen wird eine wissenschaftliche und ökonomische Kontroverse über die Gründe für den Rückgang der Population von Kammmuscheln in der St. Brieuc-Bucht und die Versuche dreier Meeresbiologen, für diese Population eine Regenerationsstrategie zu entwickeln, beschrieben. In den Versuchen dieser Forscher werden im Übersetzungsprozess vier ›Momente‹ unterschieden, die dazu dienen, sich selbst und ihre Definition der Situation auf andere zu übertragen: … Problematisierung: die Forscher versuchten in diesem Drama für andere Akteure unentbehrlich zu werden, indem sie die Natur und deren Probleme definierten und davon ausgingen, dass diese gelöst würden, wenn die Akteure durch den obligatorischen Passagepunkt (OPP) des Forschungsprogramms der Wissenschaftler hindurchgingen ….«
Ein »OPP« liegt also vor, wenn es Beteiligten gelingt, eine soziale Situation so zu definieren, dass bestimmte Eckpunkte, auf die sie Einfluss haben, von anderen als Voraussetzung weiteren gemeinsamen Handelns anerkannt werden. Im Beispiel Callons war es die Anerkennung eines Forschungsbedarfs. Aber auch der automatische Türschließer, der von jedem, der hindurch will, eine Kraftanstrenung verlangt, wird zum OPP stilisiert An anderer Stelle erfahren wir, dass ein OPP zwei Netzwerke verbindet. Man denkt sogleich an zwei Begriffe aus der Netzwerktheorie, nämlich an den Hub, einen zentralen Knoten, der für viele Knoten die einzige oder jedenfalls die wichtigste Verbindung zu anderen bildet. Die Knoten, die für ihre Verbindungen auf den Hub angewiesen sind, bilden dann ein Cluster, und sodann an die Brücke, welche die von Roland S. Burt so genannten strukturellen Löcher schließt, indem sie den Sprung von Netzwerk zu Netzwerk, der anscheinend weit entfernte Knoten leicht erreichbar macht. Aber der Netzwerkbegriff ist in diesem Zusammenhang eher irreführend. Es geht um Situationsbeschreibungen, in denen Menschen und Objekte interagieren, indem sie sich wechselseitig Eigenschaften und Handlungsmöglichkeiten zuschreiben. Auch Latour selbst hat Probleme mit dem Netzwerkbegriff:
»Nun, da das World Wide Web existiert, glaubt jeder zu verstehen, was ein Netzwerk ist. Wahrend es vor 20 Jahren noch etwas Frische in dem Begriff als kritischem Werkzeug gegenüber so unterschiedlichen Ideen wie Institution, Gesellschaft. Nationalstaat und – allgemeiner – jeder flachen Oberfläche gab, hat er jegliche Schärfe verloren und ist nun der Lieblingsbegriff all jener, die die Modernisierung modernisieren wollen. ›Nieder mit rigiden Institutionen,‹ sagen sie alle, ›lang leben flexible Netzwerke‹.« (Latour, Über den Rückruf der ANT, in Belliger/Krieger, 561-572, S. 561)
Dem wird man gerne zustimmen. Die Fortsetzung des Zitats zeigt indessen, dass Latour nicht zwischen technischen Netzen, semantischen Nezten und sozialen Netzwerken unterscheidet. Das ist zwar in der ANT angelegt, wird dadurch aber nicht besser:
»Welcher Unterschied besteht zwischen dem älteren und den» neuen Gebrauch? Früher bedeutete das Wort |Netzwerk noch eindeutig, wie Deleuzes und Guartaris Begriff ›Rhizom‹, eine Reihe von Transformationen – Über Setzungen, Umformungen –. die nicht von irgendeinem traditionellen Begriff der Sozialtheorie erfasst werden konnten. Mit der neuen Popularisierung des Wortes Netzwerk bedeutet es nun Transport ohne Deformation, einen unmittelbaren und unvermittelten Zugang zu jeder Einzelinformation. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir meinten. Was ich ›Doppelklick-Information‹ nennen möchte, hat das letzte bisschen der kritischen Schärfe aus dem Begriff ›Netzwerk‹ genommen. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch verwenden sollten, zumindest nicht, um die Art von Transformationen und Ubersetzungen zu bezeichnen, die wir erforschen wollen.« (Latour, ebd. S. 561f)
In der Tat, auch mit ihrem Netzwerkbegriff führt die ANTin die Irre. Für mich jedenfalls ist die ANT kein OPP, sondern ein ASOG (Ansammlung soziologischer Gartenzwerge). Diese natürlich zu grobe Zurückweisung richtet sich nicht nur gegen die provozierenden Irreführungen, sondern stützt sich auch auf eine weithin geteilte Kritik. Zwar lenkt die ANT die Aufmerksamkeit auf ein Defizit der Soziologie im Umgang mit der Technik. Aber die ANT selbst befasst sich mit Gartenzwergen in der Gestalt von Türschließern, Bodenschwellen oder Schusswaffen. Rottenburgs Aufsatz, der OPP im Titel trägt, ist trotzdem gelungen.
»Die Krönung des Übersetzungsprozesses besteht in der Regel darin, den Makroakteur formal als OPP zu installieren. Es kommt etwa zur Übernahme eines einflußreichen Postens wie desjenigen eines Institutsdirektors sowie zur Besetzung von Gutachterpositionen und zur Mitarbeit in Berufungskommissionen.«
Diese und andere Sachaussagen wären auch ohne die von der ANT übernommene Dekoration triftig. In den »Travelling Models« von 2014 begegnet (auf S. 14) nur noch eine verstümmelte Version der OPP in der Gestalt von Mediatoren.
Zurück zu Callon und Latour, um noch einen anderen ihrer Gartenzwerge zu begrüßen. Es sind die »Black Boxes«, auf die sich die »Makroakteure« stützen. Rottenburg hat sie in seinem großen Park von 2002 – wenn ich richtig gezählt habe – immerhin fünf Mal aufgestellt (S. 47, 48, 88, 89, 93).
»Ein Akteur wächst mit der Anzahl von Beziehungen, die er oder sie in so genannten ›Black Boxes‹ ablegen kann. Eine Black Box enthält, was nicht länger beachtet werden muss – jene Dinge, deren Inhalte zum Gegenstand der Indifferenz geworden sind. Je mehr Elemente man in Black Boxes platzieren kann – Denkweisen, Angewohnheiten, Kräfte und Objekte –, desto größer sind die Konstruktionen, die man aufstellen kann. … Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei Makro-Akteuren um Mikro-Akteure handelt, die über vielen (undichten) Black Boxes platziert sind. Sie sind weder größer noch komplexer als Mikro-Akteure; im Gegenteil verfügen sie über dieselbe Größe und sind tatsächlich einfacher als Mikro-Akteure …« (Callon/Latour S. 83f)
Eine Black Box ist ein Komplex, der mindestens vorläufig nicht mehr in Frage gestellt und aufgedröselt wird. Latour demonstriert das an einem technischen Beispiel:
»Man nehme z.B. einen Tageslichtprojektor. Er ist ein Punkt in einer Handlungsfolge (sagen wir einmal in einer Vorlesung), eine ruhige und stumme Vermittlungsinstanz, die für selbstverständlich gehalten und vollkommen von ihrer Funktion bestimmt wird. Nun nehmen wir an, dass der Projektor nicht mehr funktioniert. Die Krise erinnert uns an die Existenz des Projektors. Wenn die Monteure ihn umringen, diese Linse justieren, jene Birne befestigen, werden wir uns bewusst, dass der Projektor aus mehreren Teilen gemacht ist, jedes mit seiner Rolle, semer Funktion und seinen rrlativ unabhängigen Zielen. Während der Projektor vor einem Augenblick kaum existiert hatte, besitzen nun sogar seine Teile individuelle Existenz, jedes seine eigene ›Black Box‹. In einem Moment wuchs unser ›Projektor‹ von einer Komposition aus null Teilen zu einer aus einem bis zu vielen Einzelteilen.«
Die »Travelling Models« von 2014 zollen den Black Boxes nur in der Einleitung (S. 4 u. 13) Reverenz und verwenden den Ausdruck dort anders als Callon und Latour. Sie wollen keine Black Boxes identifizieren, in den Akteure mögliche Problempunkte verstecken, sondern die den Forschern unbekannte »Black Box« des Wanderungsprozesses öffnen.
Man findet bei Latour auch Formulierungen, die zu dem Konzept der kulturellen Übersetzung passen. Nach dem
»Modell der Übersetzung … liegt die Verbreitung aller Elemente in Zeit und Raum (Ansprüche, Anordnungen. Artefakte, Güter) in den Händen von Personen; jede dieser Personen kann auf viele verschiedene Arten handeln, den Token fallenlassen, ihn modifizieren, ablenken oder betrügen, ihm etwas hinzufügen oder ihn sich aneignen. Die getreue Übermittlung einer Anordnung z.B. durch eine große Anzahl an Personen ist in solch einem Modell rar – und falls sie auftritt, erfordert sie eine Erklärung.« (Latour S. 198)
Das ist trivial, es sei denn, man problematisiert das »kann«. Es folgt die Ball-Metapher , auf die Rottenburg anspielt:
»Noch wichtiger ist, dass die Verlagerung nicht von einem initialen Impetus verursacht wird, da der Token keinen wie auch immer gearteten Impetus hat; vielmehr ist sie die Konsequenz einer Energie, die dem Token von jedem Element der Kette verliehen worden ist, das etwas mit ihm macht, wie etwa im Fall von Rugbyspielern und einem Ball. Die Initialkraft des Ersten in der Kette ist nicht wichtiger als die der zweiten, der 40. oder der 400. Person; folglich ist klar, dass die Energie weder angehäuft, noch kapitalisiert werden kann.« (Latour S. 199)
Das ist alles andere als klar. Warum keine Initialkraft? Wäre nicht Rottenburgs »Aura« eine solche? Und warum soll der Schwung (die »Trägheit«) des Tokens sich nicht verstärken, wenn doch jeder Spieler etwas hinzufügen kann? Zehn Jahre später schreibt Latour immerhin:
»A ball going from hand to hand is a poor example of a quasi-object, since, although it does trace the collective and although the playing team would not exist without the moving token, the latter is not modified by the passings.«
Dass die Rugby-Metapher in die Irre führt, wird vollends klar, wenn Latour sich mit dem »dritten und wichtigsten Aspekt des Übersetzungsmodells« wieder von ihr verabschiedet.
»Jede der Personen in der Kette setzt nicht einfach einer Kraft Widerstand entgegen oder übermittelt sie auf die Art, wie es im Diffusionsmodell geschehen würde; stattdessen tut sie etwas Wichtiges für die Existenz und Aufrechterhaltung des Tokens. In anderen Worten besteht die Kette aus Akteuren (nicht passiven Vermittlern), und da der Token sich der Reihe nach in der Hand jedes Einzelnen befindet, formt ihn jeder entsprechend der verschiedenen Projekte. Aus diesem Grund heißt es Übersetzungsmodell: Der Token verändert sich, während er von Hand zu Hand geht, und die getreue Übertragung einer Aussage wird zu einem ungewöhnlichen Einzelfall unter viel wahrscheinlicheren anderen.« (Latour S. 199)
Das hätte man einfacher haben können. Mit Latours eigener Formulierung:
»No transportation without transformation.«
Oder auf deutsch: Stille Post. Mein Eindruck ist, dass man in Halle die Arbeiten von Callon und Latour doch nur als eine Theorie der kulturellen Übersetzung rezipiert hat wie in dieser Formulierung von Rottenburg:
»Diese Leistung des Anbietens einer neuen Interpretation nenne ich im Anschluß an Michel Callon und Bruno Latour (die auf Michel Serres zurückgreifen) Übersetzung. Alte und vertraute Elemente werden mit frischen, unbekannten Elementen zu einer neuartigen Geschichte zusammengefügt und bekommen dadurch einen anderen Sinn.« (OPP. Geschichten zwischen Europa und Afrika, 1995 S. 93)
Die »Travelling Models« von 2014 bekennen sich zur ANT. Nicht nur in der theoretischen Einleitung, sondern auch in mehrern Einzeluntersuchungen fällt der Begriff »translation« . Ich muss noch einmal gründlicher lesen, um ob hier die Machttheorie von Callon und Latour rezipiert ist oder ob es bei der Theorie der kulturellen Übersetzung bleibt.
Ähnliche Themen