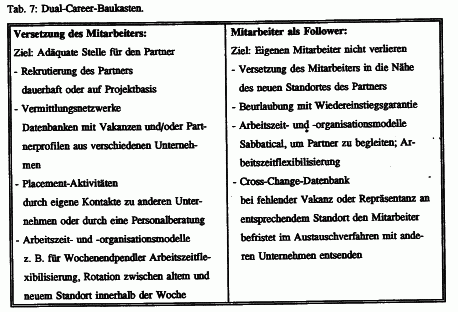Dies ist die frühere »Seite« Fundbüro. Bei einem WordPress-Blog wie diesem werden die Texte in »Seiten« und »Einträge« unterteilt. Die Seiten bilden das Gerüst, das immer sichtbar ist und über Kopfzeile aufgerufen werden kann. Die »Beiträge« dagegen sind chronologisch geordnet. Beim Aufruf des Blogs erscheint immer der jüngste Beitrag. Die älteren rutschen nach unten. Rsozblog ist jetzt acht Jahre alt. Da muss auch das Gerüst einmal umgebaut werden. Dazu habe ich die veraltete Fundbüro-Seite in einen Eintrag umgewandelt und sie unter dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum eingereiht. An die Stelle dieser Seite tritt eine neue mit Titel »Nachträge«.
Das Fundbüro wird geschlossen.
Wer meinen Blog verfolgt, wird bemerkt haben, dass ich schon lange keine Fundstücke mehr gesammelt habe. Es gibt einfach zu viele wichtige Texte, die im Internet verfügbar sind. Wenn man etwas sucht, lohnt es sich stets, danach zu gugeln. Ich will aber auch gerne einräumen, dass es mir schlicht zu mühsam ist, Fundstücke im Fundbüro einzuordnen, zumal die WordPress-Software für die Formatierung einer solchen Liste sehr unbequem ist. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die bibliographischen Angaben einfach aus Citavi in das Fundbüro zu übernehmen. Daher wird das Fundbüro nun – im Juli 2010 – geschlossen.
Das Fundbüro vor der Schließung:
Auf dieser Seite werden die Links und vor allem die Fundstücke zur Rechtssoziologie abgelegt, die auf der Startseite keinen Platz mehr haben. Der Hyperlink verweist in einigen Fällen nicht direkt auf den Text, sondern auf eine Webseite, von der man weiter findet.
Rechtssoziologische Literatur im Internet
Bourdieu, Pierre, The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, mit einer Einführung des Übersetzers Richard Terdiman (S. 805-813), The Hastings Law Journal 38 , 1987, 814-853
Fischman, Joshua B. and Law, David S., What Is Judicial Ideology, and How Should We Measure It? (October 19, 2008). Washington University Journal of Law and Policy, Vol. 29, No. 1, 2008; 3rd Annual Conference on Empirical Legal Studies Papers; San Diego Legal Studies Paper No. 08-47. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1121228
Grossman Joel B., Herbert M. Kritzer, and Macaulay, Do the ‘Haves’ Still Come Out Ahead? 33 Law & Society Rev. 803-810 (1999)
Kenworthy, Lane, Macaulay,Stewart, and Joel Rogers, “The More Things Change . . . “: Business Litigation and Governance in the American Automobile Industry, 21 Law and Social Inquiry, 631-678 (1996).
Macaulay, Stewart, Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study, 28 American Sociological Rev. 1-19 (1963) (Links zu dieser und den folgenden Arbeiten von Macaulay auf seiner Webseite)
ders., Changing a Continuing Relationship Between a Large Corporation and Those Who Deal With It: Automobile Manufacturers, Their Dealers, and the Legal System, Law and Society, 483 Wisconsin L. Rev. 3-212 (1965)
ders., Lawyers and Consumer Protections Laws, 14 Law & Society Review, 115-171 (1979)
ders., Law Schools and the World Outside Their Doors II: Some Notes on Two Recent Studies of the Chicago Bar, 32 Journal of Legal Education 506-542 (1982)
ders., Law and Behavioral Science: Is There Any There There?, 6 Law & Policy 149-187 (1984)
ders., Elegant Models, Empirical Pictures, and the Complexities of Contract, 11 Law & Society Review 507-528 (1977)
ders., Private Government, in: Lipson & Wheeler (eds.) Law and Social Science, (Russell Sage Foundation: 1986), pp. 445-518
ders., Images of Law in Everyday Life: The Lessons of School, Entertainment, and Spectator Sports, 21 Law & Society Review 185-218 (1987)
ders., The Future of American Lawyers, 2 Sociologia del diritto, 51-69 (1993)
ders., The Impact of Contract Law on the Economy: Less Than Meets the Eye? Paper given at a Conference on Law and Modernization, Lima Peru, July, 1994
ders., Crime and Custom in Business Society, 22 Journal of Law and Society 248-258 (1995)ders., The Last Word, 22 Journal of Law and Society 149-154 (1995)
ders., Organic Transactions: Contract, Frank Lloyd Wright and the Johnson Builidng, 1 Wisc. L. Rev. 74-121 (1996)
ders., Realational Contracts Floating on a Sea of Custom? Thoughts About the Ideas of Ian Macneil and Lisa Bernstein, 94 Nw. U. L. Rev. 775-804 (2000)
ders., The Real and the Paper Deal: Empirical Pictures of Relationships, Complexity and the Urge for Transparent Simple Rules, 66 Modern L. Rev. 44-79 (2003)
ders., Freedom From Contract: Solutions in Search of a Problem? Wisconsin L. Rev. 777-820 (2004)
ders., The New Versus The Old Legal Realism: “Things Ain’t What They Used to Be”, Wisconsin L. Rev. 367-403 (2005)
Marx, Werner/Gramm, Gerhard, Literaturflut – Informationslawine – Wissensexplosion
Wächst der Wissenschaft das Wissen über den Kopf?, 1994/2002
Tamanaha, Brian Z., A Concise Guide to the Rule of Law. FLORENCE WORKSHOP ON THE RULE OF LAW, Neil Walker, Gianluigi Palombella, eds., Hart Publishing Company, 2007; St. John’s Legal Studies Research Paper No. 07-0082. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1012051
ders., The Dark Side of the Relationship between the Rule of Law and Liberalism. ; NYU Journal of Law and Liberty, Vol. 33, 2008; St. John’s Legal Studies Research Paper No. 08-0096. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1087023
ders., Law; Oxford International Encyclopedia of Legal History, 2008 ; St. John’s Legal Studies Research Paper No. 08-0095. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1082436
ders., The Bogus Tale About the Legal Formalists (April 2008). St. John’s Legal Studies Research Paper No. 08-0130. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1123498
ders., Understanding Legal Realism(May 2008). St. John’s Legal Studies Research Paper No. 08-0133. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1127178
ders., The Distorting Slant of Quantitative Studies of Judging(October 30, 2008). Boston College Law Review, Vol. 50, 2009; St. John’s Legal Studies Research Paper No. 08-0159. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1292459
ders., A Holistic Vision of the Socio-Legal Terrain (August, 14 2008). Journal of Law and Contemporary Problems, 2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1226049
Van Aaken, Anne, Effectuating Public International Law Through Market Mechanisms? (October 31, 2008). CLPE Research Paper No. 34/2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1292787
Teubner, Gunther: Teubner stellt fast alle seine Arbeiten im Volltext auf seiner Webseite zum Download zur Verfügung: http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/em_profs/teubner/Person/PublikationenDeutsch.html.
Zumbansen, Peer, The State as ‘Black Box’ and the Market and Regulator: A Comment on Anne Van Aaken’s ‘Effectuating Public International Law Through Market Mechanisms'(October 31, 2008). CLPE Research Paper No. 35/2008. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1292789