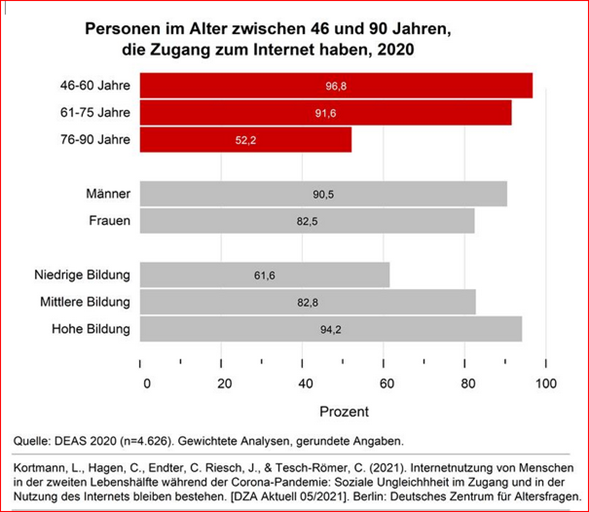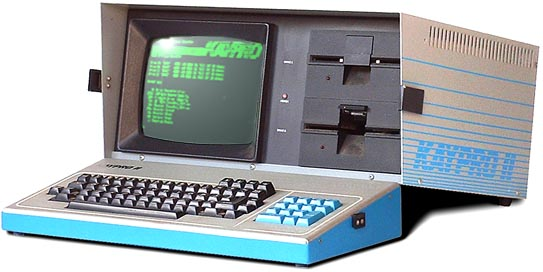Gleichheit oder Ähnlichkeit werden wie gesagt durch den Vergleich von Attributen oder Strukturmerkmalen ermittelt. Folgen die Vergleichsmerkmale einer erkennbaren Regel, sind »vollständige« oder exakte Analogien möglich. Darauf beruhen die bei Psychologen und Pädagogen beliebten Ergänzungsaufgaben, zum Beispiel, wenn dort verlangt wird, die Reihe 1 – 2 – 4 – 8 mit 16 – 32 usw. fortzusetzen.[1] Dabei handelt es sich um Extrapolationen, die sich formalisieren lassen.[2] Auch solche »Entdeckungen« werden in der einschlägigen Literatur als Analogie bezeichnet. Der gedankliche Vorgang ist jedoch der Subsumtion unter eine Regel vergleichbar ist. Juristen werden diese Beispiele daher kaum als Analogie ansehen. Von Ulrich Klug lernen wir, diese Beispiele als vollständige Analogien zu bezeichnen, weil sie, anders als die Analogien der Juristen, über eine eindeutige Lösung verfügen.[3]
Bei der proportionalen Analogie geht es, anders als die Benennung nahelegt, nicht um ein Rechenverfahren. Es fehlen gemeinsame Merkmale, die auf der Basis eines semantischen Konzepts miteinander verglichen werden können. Verglichen werden vielmehr zwei Paare von ungleichen Objekten nach dem Vorbild der Gleichung A : B ≈ C : D.
Im Aristoteles-Text folgt das Beispiel von Dionysos und Ares direkt auf die Lehre von der Metapher[4]. Metapher und Analogie werden oft gleichgesetzt. Daher zunächst ein anderes Beispiel, bei dem die Metapher ins Auge springt: Sagt die Prinzessin Eboli zu Don Carlos (nachdem sie entdeckt hat, dass Carlos die Königin liebt), sie sei ein beleidigter Tiger, so wird man diese Redeweise sofort als Metapher erkennen, mit der Eigenschaften von einem auf das andere Objekt übertragen werden. Doch damit wird der Gedankengang verkürzt. Hier ist klar, dass Eboli und Tiger ungleich sind. Es soll aber gesagt werden, dass beide über ähnliche Eigenschaften verfügen, die man nicht ohne weiteres wahrnehmen kann. Bei näherer Hinsicht sind vier »Objekte« (auch Handlungsweisen sind insoweit »Objekte«[5]) und ein tertium comparationis im Spiel.
Eboli (A) Tiger (B)
intrigiert (C) springt Opfer an (D).
Tertium comparationis ist eine Relation, das Verhalten gegenüber Mitgeschöpfen.
Das Beispiel soll zeigen: Eine Metapher ist insofern Analogie, als sie als ungleicher Vergleichskandidat genutzt wird, um eine Eigenschaft von Kandidat B auf Kandidat A zu transportieren (zu entdecken oder ihm zuzuschreiben), die A nicht zukommt oder die man ohne den Vergleich (vielleicht) nicht bemerkt hätte. Psychologen sprechen von relationalem Denken, weil die Beziehung (relation) B→D auf A→C übertragen wird, und sie definieren daher:
»Analogical reasoning is a kind of reasoning that is based on finding a common relational system between two situations, exemplars, or domains.«[6]
Dem Juristen bleibt unklar, wie das Hirn die Abstraktionsleistung vollbringt, die in dem »common« steckt. Ihm erscheint die Definition zirkulär, denn die innovative Leistung analogen Denkens liegt doch wohl drin zu entdecken, dass zwei durchaus unterschiedliche Relationen etwas gemeinsam haben. Er erfährt immerhin, dass Metaphern als Vergleichskandidaten hilfreich sind, denn mit ihnen lassen sich Gedanken aus vertrauten und konkreten Bereichen auf weniger vertraute oder abstrakte Felder zu übertragen.[7] Doch er rätselt weiter, welche kognitiven Prozesse Metaphern überhaupt erst möglich machen.
Im Analogiebeispiel des Aristoteles ist es nicht ganz einfach zu erkennen, was zwischen den Kandidaten transportiert wird. Becher und Schild dienen nicht sogleich als Metaphern. Erst die Analogie verleiht ihnen Metaphernqualität. Das tertium comparationis bleibt unbenannt oder, wie Aristoteles sagt, es wird nur gelegentlich beigefügt. Man kann den Becher nur dann als Schild des Dionysos ansprechen, wenn man als Vergleichsmerkmal »Erkennungszeichen« im Kopf hat. Bei dieser proportionalen Analogie ist der Vergleichsmaßstab erst das fünfte Rad am Wagen. Dionysos, der Gott des Weines, und der Kriegsgott Ares verfügen mit Becher und Schild beide schon über ihr Erkennungszeichen. Der Übertragungseffekt wäre leichter ersichtlich, wenn die Gleichung eine Unbekannte enthielte:
Der Becher verhält sich zu Dionysos wie X zu Ares (oder umgekehrt).
Was wir durch die Analogie hinzulernen, ist der Umstand, dass Becher und Schild für Dionysos und Ares, obwohl so verschieden, die gleiche Funktion erfüllen. Die Proportionen von Dionysos und Ares einerseits und von Becher und Schild andererseits stimmen nicht quantitativ überein, sondern entsprechen einander qualitativ. Becher und Schild werden oft als »Attribute« der beiden Götter bezeichnet. Es handelt sich aber nicht um schlichte Attribute im Sinne von Oberflächenmerkmalen (properties), sondern um einzigartige Kennzeichen, einzigartig insofern, als sie je für sich ausreichen, um ihren Träger nicht nur zu identifizieren, sondern auch zu charakterisieren. Becher und Schild sind Zeichen oder gar Quelle der göttlichen Kraft ihrer Träger. Es handelt sich um Metonyme, denn sie stehen pars pro toto für den ganzen Gott. Die Ähnlichkeit folgt nicht aus einer formalen Proportion, sondern aus einer Übereinstimmung der Tiefenstruktur. Das ist eine ziemlich komplizierte Relation. Erst wenn man die Analogie des Aristoteles kennt und billigt, eignen sich Becher und Schild auch als Metaphern. Dann steht der Becher für rauschhafte Lebensfülle und der Schild für kriegerische Tapferkeit.
Als Standardwerk der Argumentationstheorie gilt »Die neue Rhetorik« von Perelman und Olbrechts-Tyteca.[8] Wohlrapp hält deren Analyse der Analogie für die beste in der gängigen Argumentationsliteratur, weil es ihnen gelinge, das verbreitete Verständnis der Analogie als einer verkappten Induktion zu vermeiden[9], aber das gelingt doch nur um den Preis einer Umdefinition[10]. In der Konsequenz billigen Perelman/Tyteca der Analogie in der Jurisprudenz nur einen sehr beschränkten Anwendungsbereich zu:
»In the field of law, reasoning by true analogy appears to be restricted to comparison as to particular points of systems of positive law separated by time, place, or content. On the other hand, whenever resemblances between entire systems are sought, the systems are regarded as examples of a universal system of law. Similarly, whenever someone argues in favor of the application of a given rule to new cases, he is thereby affirming that the matter is confined to a single domain. Accordingly, if pursuant to the wish of certain jurists to see in analogy something more than the term by which one’s opponent’s example is disqualified, there is to be a rehabilitation of analogy as a device for wider interpretation, this result can be achieved only if analogy is given a different meaning from the one we have proposed.«[11]
Der Grund liegt darin, dass sie – das zeigt das Ende des Zitats – die Analogie, der scholastischen Tradition entsprechend, als analogia proportionalis bestimmen. Zudem verlangen sie, dass die ins Verhältnis gesetzten Objekte unterschiedlichen ontologischen Bereichen angehören. Nun könnte man wohl die Gesetzesanalogie in eine proportionale Analogie übersetzen nach dem Muster: Fall A verhält sich zur Rechtsfolge RA wie Fall B zur Rechtsfolge RB. Aber damit ist nichts gewonnen, denn es fehlt das tertium comparationis. Die zweite Vorbedingung der ontologischen Differenz wäre ohnehin bei der Gesetzesanalogie nicht erfüllbar.[12]
Zurück zu Aristoteles. Sein Beispiel zeigt, wie sehr Analogiebildung vom Vorwissen abhängt. Nur wer mit der Mythologie vertraut ist, kann die Idee eines so überraschenden Vergleichs fassen. Das Vorwissen wird in jeder Phase der Analogiebildung relevant. Das beginnt bei der Strukturierung, dem »Mapping« der Ausgangs- oder Problemsituation. Je nach Vorwissen kommen unterschiedliche Attribute und Relationen in den Blick. Je umfangreicher das Vorwissen, um so mehr verlagert sich der Abbildungsprozess von singulären Objekten, einfachen Attributen und schlichten Relationen auf Prädikate höherer Ordnung (Knoten und Relationen über Relationen)[13]. Bei der Suche nach Vergleichskandidaten und noch einmal zur Vorbereitung des Urteils über die Ähnlichkeit kann es auch helfen, nach Kontrasten zu suchen. Analogie und Gegensatzbildung mit Antonymen ergänzen sich wechselseitig. Aber auch Gegensatzbildung baut auf Vorwissen. Tieferes Wissen führt so zu den Tiefenstrukturen der Vergleichskandidaten.
Die Tiefenstruktur des Aristoteles-Beispiels würde sich heute wohl mit den Instrumenten der KI konzeptualisieren und damit formalisieren lassen. Aber das wäre nur ein winziger Ausschnitt aus der Welt des objektiven Geistes[14]. Komplexität lässt sich wohl stückweise immer wieder einmal auflösen. Aber es ist schwer vorstellbar, dass alle im sozialen Gedächtnis gespeicherten Gedankenverbindungen formalisiert werden könnten.
Im Aristoteles-Beispiel ist die Analogie kein Rechenverfahren, aber es wird eine Relation übertragen, die sich kognitiv erfassen lässt. Auch Psychologen und Pädagogen, meinen, wenn sie von Analogien sprechen, stets nur die Übertragung von kognitiven Relationen. Gesetzesanalogien verlangen die Übertragung einer normativen Relation. Die Erfolgsbedingungen für kognitive und für normative Analogien dürften unterschiedlich sein.
Diesen Unterschied betont mit handlichen Beispielen Weinreb.[15] Im Alltag verwenden wir ständig Analogien, ohne uns viel darum zu kümmern, auf Grund welcher Gesetzmäßigkeiten sie funktionieren. Auf einen Rotweinflecken im Tischtuch streut man Salz. Da wird man dieses Rezept auch bei einem Flecken von rotem Cranberry-Saft probieren, ohne sich über den Wirkungsmechanismus Gedanken zu machen. Allerdings lässt sich anschließend feststellen, ob die Analogie erfolgreich war, und man könnte sich auch über den zugrunde liegenden chemisch-physikalischen Prozess informieren. Für normative Analogien gibt es keine vergleichbare Erfolgskontrolle. Dennoch, so Weinreb, könne man auf normative Analogien nicht verzichten.[16]
Normative Relationen stehen im Mittelpunkt der Argumentationstheorie. Daher befasst sich die Fortsetzung zunächst mit den Begriffen der Argumentationstheorie.
[1] Beispiele bei Markus Ruppert, Wege der Analogiebildung, 2017, S. 16ff. Es handelt sich um die im Internet verfügbare Dissertation eines Mathematikers mit guten Referaten der Literatur.
[2] Der dafür erforderliche Aufwand ist erheblich, das Ergebnis beinahe trivial. Das zeigt das Tee-mit/ohne-Milch-und-Zucker-Beispiel von Prade und Gilles (Henri Prade/Gilles Richard, Analogical Proportions and Analogical Reasoning – An Introduction, in: David W. Aha/Jean Lieber (Hg.), Case-Based Reasoning Research and Development, 2017, 16-32, S. 31).
[3] Ulrich Klug, Juristische Logik, 3. Aufl., 1966, S. 103. Klug bezieht sich dazu auf Moritz Wilhelm Drobisch, Neue Darstellung der Logik nach ihren einfachsten Verhältnissen mit Rücksicht auf Mathematik und Naturwissenschaft, 5. Aufl. 1887.
[4] Die Metaphern-Literatur ist unendlich. Eine gute Darstellung bietet der Artikel »Metapher« von Monika Schmitz-Emans. Er war für ein geplantes Internetlexikon bestimmt und ist noch über eine italienische Webseite erreichbar: https://sites.unimi.it/dililefi/costazza/corsi/2010-11/Metapher-Schmitz-Emans.pdf. Für einen jüngeren Überblick Lotte van Poppel, The Study of Metaphor in Argumentation Theory, Argumentation 35, 2021, 177-208.
[5] Barbot u. a. würden das Beispiel als einen speziellen Fall analoger Proportionalität, nämlich als relationale Proportionalität, einordnen. Um analoge Proporionalität soll es sich handeln, wenn gesagt wird, A verhält sich zu B wie C zu D. Relational wird der Vergleich genannt, wenn er besagt, A stehe in einem ähnlichen Verhältnis zum Attribut a wie B zum Attribut b (Nelly Barbot/Laurent Michet/Henri Prade, Relational Proportions Between Objects and Attributes, Internetpaper 2018.
[6] D. Gentner/L. Smith, Analogical Reasoning, in: Encyclopedia of Human Behavior, 2012, 130-136, S. 130.
[7] Dedre Gentner u. a., Metaphor Is Like Analogy, in: Dedre Gentner u. a. (Hg.), The Analogical Mind, Perspectives From Cognitive Science, 2001, 199-253, S. 202.
[8] Chaïm Perelman/Lucie Olbrechts-Tyteca, Die neue Rhetorik. Eine Abhandlung über das Argumentieren, 2004 [La nouvelle rhétorique 1958]. Ich zitiere nach der englischen Übersetzung (The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation, 1969).
[9] Harald Wohlrapp, The Concept of Argument, 2014, S. 151 Fn. 36. Wohlrapp stützt sich auf die von ihm betreute Dissertation von Peter Mengel, Analogien als Argumente, 1995, dort S. 63ff.
[10] Maciej Koszowski, Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca’s Account of Analogy Applied to Law: the Proportional Model of Analogical Legal Reasoning, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społeczne 13, 2016, 5-13.
[11] Perelman/Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric, S. 374.
[12] Koszowski S. 12.
[13] Markus Ruppert, Wege der Analogiebildung, 2017, S. 39.
[14] Diesen Begriff meine ich nicht im Sinne Hegels, sondern verwende ihn schlicht für alle Gedanken, die irgendwann und irgendwo geäußert worden sind und die sich aus dem Gedächtnis von Individuuen oder aus ihrer Symbolisierung in irgendwelchen Medien rekonstruieren lassen. Daher spreche ich auch im Folgesatz gleichbedeutend vom sozialen Gedächtnis, denn der naheliegende Begriff des kollektiven Gedächtnisses führt zu viel Ballast mit sich. Wichtig ist hier, das überhaupt verfügbare Wissen vom Vorwissen der Individuen zu unterscheiden.
[15] Lloyd L. Weinreb, Legal Reason. The Use of Analogy in Legal Argument, 2. Aufl. 2016, S. 37ff.
[16] Ebd. S. 48.