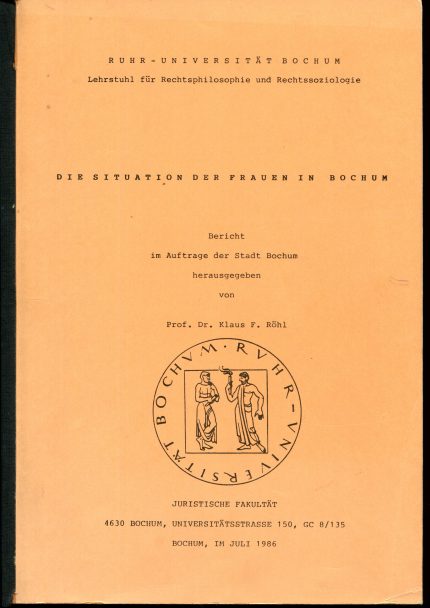Das Jahrbuch des öffentlichen Rechts, seit unvordenklichen Zeiten Hort der dogmatischen Jurisprudenz, hat in seinem jüngsten Band (NF 67, 2019) prominenten Feministinnen die Seiten 361-508 für einen Abschnitt »Debatte: Perspektivenerweiterung durch Genderforschung in der Rechtswissenschaft« überlassen.
Es handelt sich um insgesamt sechs Beiträge.
Catharine A. MacKinnon im Gespräch mit Susanne Baer: Gleichheit, realistisch, S. 361-375.
Ute Sacksofsky, Geschlechterforschung im öffentlichen Recht, S. 377-402.
Eva Kocher, Die Position der Dritten. Objektivität im bürgerlichen Recht, S. 403-426.
Friederike Wapler, Politische Gleichheit: Demokratietheoretische Überlegungen, S. 427-455.
Elisabeth Holzleithner, Geschlecht als Anerkennungsverhältnis. Perspektiven einer Öffnung der rechtlichen Kategorie im Zeichen des Prinzips gleicher Freiheit, S. 457-485.
Theresia Degener, Die UN Behindertenrechtskonvention – Ansatz einer inklusiven Menschenrechtstheorie, S. 488-508.
Die Kennzeichnung als Debatte täuscht, denn es gibt keinen Beitrag, der das Postulat der Überschrift in irgendeiner Weise in Frage stellt. Zu den einzelnen Beiträgen:
In den USA gab es seit Ende der 1970er Jahre eine Feminist Jurisprudence. Dort ragte der Name von Catharine A. MacKinnon hervor, die einen radikalen Feminismus vertrat, wie er später ähnlich in Deutschland von Alice Schwarzer formuliert wurde. Angetrieben von der Idee, dass das biologische Geschlecht nicht die Rolle eines Menschen in der Gesellschaft bestimmen dürfe, durchforsteten MacKinnon und andere Juristinnen das Recht nach Spuren männlicher Dominanz. Das hatte zur Folge, dass der Feminismus als Wissenschaft zuerst in die juristischen Fakultäten Eingang fand.[1] MacKinnon brandmarkte die männliche Sexualität schlechthin als Quelle allen Übels. Heterosexuelle Beziehungen seien durch eine Ideologie der Verdinglichung charakterisiert, die Frauen als bloße Objekte männlicher Sexualität verstehe. Dieser Dominanzfeminismus machte geltend, die Unterdrückung der Frauen sei das Ergebnis männlichen Sexualität, sie sei prinzipiell mit Gewalt oder jedenfalls Gewaltdrohung verbunden. Das Ergebnis war ein männerfeindlicher Feminismus, der sich auf rechtlichem Gebiet besonders gegen Prostitution und Pornographie wandte[2] und die Kriminalisierung der sexuellen Belästigung (sexual harassment) betrieb. Eine späte Frucht des Dominanzfeminismus ist die #Metoo-Bewegung.
Im Gespräch mit Susanne Baer bestätigt MacKinnon ihre dominanzfeministische Position, die Verurteilung von Prostitution als »serielle Vergewaltigung« und von Pornographie als deren kleine Schwester.
Man wird nicht widersprechen, wenn MacKinnon erklärt, es »sollte vor allem zur Kenntnis genommen wird, dass in Ungleichheit nicht jedes Mal eingewilligt wird, wenn sie nicht auf Widerstand trifft. Den halben Lohn zu akzeptieren, macht ihn nicht gleich. Unter Bedingungen der Ungleichheit zu leben, wenn gleiche Alternativen keine Option sind, ist keine Gleichheit.« (S. 370) Es bleibt allerdings der Eindruck, dass sie das Geschlecht per se für Ungleichheit verantwortlich macht, allenfalls in Kombination mit Rasse. Baer legt MacKinnon geradezu in den Mund, der Rassebegriff sei doch obsolet. Doch MacKinnon antwortet: »Es gibt race. Dann gibt es racism. Und dann gibt es white supremacy.« (S.363).
Kehrseite des radikalen Feminismus, für den MacKinnon steht, war einmal ein Differenzfeminismus.[3] Ausgehend von der weiblichen Körperlichkeit und der mit ihr verbundenen Gebärfähigkeit wurden die positiven Qualitäten »weiblichen« Sozialverhaltens wie Empathie, Intuition und ganzheitliche Wahrnehmung betont. Davon ist heute keine Rede mehr. Die Allianz mit der Queer-Theorie hindert den Feminismus, ein positives Frauenbild zu formulieren.
Ute Sacksofsky (Geschlechterforschung im öffentlichen Recht, S. 377-402) hebt an mit einer Klage über das »misogyne Recht«. Als Zeugen benennt sie Hegel. Hegel ist schon lange tot, mag auch sein Weltgeist noch im Bochumer Hegel Archiv spuken. Darunter muss keine Frau mehr leiden. Es gibt viele verdienstvolle Arbeiten zur Geschlechtergeschichte. Aber das daraus reproduzierte Narrativ zehrt von einem normativen Rückschaufehler.[4]
Sodann erweist Sacksofsky dem Queerfeminismus ihre Reverenz. Erst muss die Natürlichkeit und Normalität der herkömmlichen Geschlechterordnung dekonstruiert werden, bevor es zur Sache geht. Aber für das feministische Anliegen ist es nicht notwendig, einen »biologischen Mythos« zu »entlarven«. Auch wenn das Geschlecht im Normalfall biologisch/körperlich vorgegeben ist, bleibt doch der unterschiedliche soziale Status von Frauen und Männern unter den Bedingungen der Moderne ein Problem, das mit gutem Grund und allem Nachdruck unter dem Aspekt der Gleichheit erörtert werden muss. Die Randphänomene des biologischen Normalfalls begründen auch ein Problem, aber ein anderes.[5]
Tempora mutantur nosque mutamur in illis. Wo bleibt der Stolz auf das in nunmehr 171 Jahren Frauenbewegung Erreichte? Das Recht ist von oben bis unten, vom Völkerrecht, über Europarecht, Grundgesetz und einfaches Recht bis hin zur Geschäftsordnung der Bundesregierung auf Gender Mainstreaming getrimmt. In Deutschland gibt es fast so viele Gleichstellungsbeauftragte wie Richter.
Die Geschlechterforschung hat in den 1970er Jahren als Feminist Jurisprudence ihren Anfang genommen. [6] 2003 konnte Stefan Hirschauer schreiben, dass der »feministische Wertehorizont … längst mit einem gesellschaftlichen Common Sense verschwimmt«[7], und daran hat auch das Recht Anteil. Inzwischen geht die feministische Vereinnahmung des Rechts so weit, dass selbst in feministischen Traktaten von einem sich entwickelnden Staatsfeminismus die Rede ist.[8] Den Zeitgenossinnen mag der Wandel zu langsam und nicht weit genug gehen. Aber Historiker werden später mit einiger Sicherheit von einer Revolution des Geschlechterarrangements sprechen. Das sollten auch Juristinnen anerkennen.
Das öffentliche Recht braucht nicht umgekrempelt zu werden. Allein die »Trägheit der sozialen Praxis« (Hirschauer) gilt es zu bekämpfen. Freilich gehören Klagen im Stile Sacksofskys »zur Ökonomie politischer Aufmerksamkeit«. Hirschauer spricht insoweit von politischem Populismus.
Immerhin konzediert Sacksofsky in ihrem Fazit (S. 402), dass sich seit ihrer Antrittsvorlesung »Was ist feministische Rechtswissenschaft?« 2001 einiges verändert habe, beklagt aber, es fehle noch immer die institutionelle Verankerung der Geschlechterforschung in der deutschen Rechtswissenschaft. Das klingt, als ob feministische Rechtswissenschaft auf Perpetuierung angelegt wäre. Das Ziel sollte höher gesteckt werden. Der Feminismus als soziale Bewegung in Kombination mit seiner wissenschaftlichen Basis auch in der Jurisprudenz ist so erfolgreich, dass er den Ehrgeiz entwickeln könnte, sich selbst überflüssig zu machen.
Eva Kocher (Die Position der Dritten. Objektivität im bürgerlichen Recht, S. 403-426) leistet in ihrem Beitrag dogmatische Feinarbeit.
Eingangs zitiert Kocher Susanne Baer: »Objektivität wurde als ideologisch und eigentlich männlich entlarvt.«[9] Ähnliche Aussagen sind in der feministischen Rechtsliteratur Standard. Ihr Problem ist der rhetorische Überschuss, der aus der Verwendung eines undefinierten, unhistorischen Objektivitätsbegriffs resultiert. Es ist ja richtig, dass die Jurisprudenz Objektivität und Neutralität für sich in Anspruch nimmt. Doch was kann damit gemeint sein? Die Jurisprudenz war und ist nicht klüger als ihre jeweilige Zeit.
Der feministischen Objektivitätskritik geht es, ähnlich wie zuvor der Kritik an der »Klassenjustiz«, um die Aspektstruktur des Denkens, die – in der Begrifflichkeit der Wissenssoziologie Karl Mannheims – die Befangenheit einer ganzen Epoche ausmacht. Mannheim spricht insoweit von einer totalen Ideologie. Das Minimum, das wir von Mannheim übernehmen können, ist die Idee einer allgemeinen Seinsverbundenheit des Denkens. Ob man Mannheim auch darin folgen kann, dass insoweit jede Epoche von einer totalen Ideologie geprägt wird, hat Theodor Geiger bestritten[10]. Auch wenn man das gesamte Rechtssystem bei externer Betrachtung als »Klassenjustiz« einordnete, ließe sich intern, also relativ zu dem aktuell herrschenden Denkstil, sinnvoll nach Unabhängigkeit, Neutralität und »Objektivität« fragen. Analoges gilt, wenn man das gesamte Rechtssystem als patriarchalisch einordnet. Die Befangenheit einer ganzen Epoche in einem spezifischen Denkstil steht einem Selbstverständnis der Rechtsprechung als unabhängig, neutral und objektiv nicht im Wege.
Antworten auf konkrete Rechtsfragen ändern sich erst, wenn ein neuer Denkstil Platz greift. Damit das geschieht, müssen viele Rechtsfragen prospektiv kritisch von einem Standpunkt erörtert werden, der zunächst als externer erscheint, bis dann die Kritik solche Kraft gewinnt, dass der interne Denkstil Risse bekommt. Vorangetrieben wird der Wandel von sozialen Bewegungen und begleitender Wissenschaft, in diesem Falle eben vom Feminismus. In der Zeit des Wandels ist es die Strategie der Kritik, so zu reden, als rede sie von innerhalb des Rechtssystems. Diese Redeweise klingt anmaßend und geschichtsvergessen, weil sie den Denkstil der Epoche den aktuell handelnden Personen individuell zuzurechnen scheint.
Die externe Betrachtungsweise behandelt Funktionen des Rechts oder einzelner seiner Institutionen in einer Art und Weise, die sich nicht ohne weiteres in Rechtsnormen oder gar Tatbestandsmerkmale übersetzen lässt und deshalb in der juristischen Arbeit anscheinend ignoriert werden muss. Es gibt jedoch über die Zeit einen fließenden Übergang von außen nach innen. Neue Theorien des Rechts werden oft von außen an das Recht herangetragen, bis sie am Ende mehr oder weniger in die Rechtstheorie integriert sind.[11] Der interne Standpunkt ist längst nicht so hermetisch geschlossen, wie die abstrakte Gegenüberstellung glauben machen könnte. An dieser Nahtstelle setzt Kocher an.
Kocher bleibt nüchtern und sachlich. Wenn sie das Credo der feministischen Objektivitätskritik anführt, benutzt sie Anführungszeichen. Feministische Rechtswissenschaft kritisiere »den ›ideologischen‹ und ›männlichen‹ Bias der ›Objektivität‹ «. Im Zentrum des Rechtssystems stehe das Selbstverständnis der Juristen, nach dem Rechtsprechung unabhängig und neutral und das Recht objektiv sein solle. Es folgt eine Klarstellung, was mit den Begriffen gemeint ist:
»Unabhängigkeit, Neutralität und Objektivität sind aufeinander bezogen, benennen aber unterschiedliche Aspekte dessen, was dem Recht und richterlicher Entscheidungstätigkeit zugeschrieben wird. ›Unabhängigkeit‹ ist ein negativer Begriff, der die Freiheit von wirtschaftlichen, politischen, institutionell-organisatorischen und persönlichen Abhängigkeiten bezeichnet. ›Neutralität‹ bezeichnet, ebenfalls in negativer Form, eine inhaltliche Orientierung, nämlich die emotionale Behandlung eines Problems, ohne Berücksichtigung persönlicher Bindungen oder institutioneller Abhängigkeiten. ›Objektivität‹ ist demgegenüber ein Versuch, diese Perspektiven positiv zu formulieren als eine Betrachtung allein nach Maßstäben des Rechts und der Sache.« (S. 404f)
Diese Formulierung gilt nur bei rechtssysteminterner Betrachtung. Die nachfolgende Ausgangsthese Kochers, das Zentrum des Rechtssystems sei leer, spielt zwar auf die rechtssystemexterne Kritik an, die das juristische Selbstverständnis gar nicht trifft. Kocher verweist auf Josef Essers »Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung« (1970) und auf Dieter Simon, Die Unabhängigkeit des Richters (1975) und daran anschließendes Schrifttum. Aber schon bei der Methodenkritik Essers ist der rechtsexterne Standpunkt nicht mehr so klar wie vielleicht noch bei Simon.
Kocher hält sich nicht mit der externen Betrachtung des Rechtssystems auf, sondern kommt schnell zur Sache, zu der Frage nämlich, »wie das komplementäre Konzept der Objektivität in der richterlichen Praxis gefüllt wird«. (S. 405) Dazu lässt sie Revue passieren, wie die Zivilrechtsprechung ihre Urteile mit der Figur eines mehr oder weniger imaginierten, empirischen oder normativ gedachten Dritten zu objektivieren versucht. Da ziehen vorbei der bonus pater familias, der objektive Beobachter und der verständige Rechtsgenosse, der vernünftige Angehörige eines Verkehrskreises, der ordentliche Kaufmann und der unvoreingenommene Durchschnittsleser. Dabei bezieht Kocher sich vor allem auf Elena Barnerts verdienstvolle Arbeit »Der eingebildete Dritte« von 2008, der sie eine »verspätete Besprechung« widmen will.
Es ist sicher richtig, dass dieser als objektiv vorgestellte Dritte keine objektive Objektivität für sich in Anspruch nehmen kann. Er schwankt zwischen behaupteter Empirie und mehr oder weniger verdeckter Normativität. Letztlich versteckt sich hinter dem objektiven Dritten die Subjektivität des Richters. Deshalb muss man diese Argumentationsfigur aber nicht gleich als sinnlos verwerfen. Das tut auch Kocher nicht. Sie hält es zwar für denkbar, auf den »god trick«[12] mit dem objektiven Dritten zu verzichten. Tatsächlich verhilft sie dem Dritten aber zu einer feministisch inspirierten Aufrüstung. An Stelle des einen objektiven Dritten solle man die verschiedene Positionen Revue passieren lassen. Dazu bezieht Kocher sich auf das Konzept der Positionalität[13], wie es von Katherine T. Bartlett[14] entwickelt wurde. Bartletts Aufsatz ist schon 30 Jahre alt. Aber er lohnt auch heute noch die Lektüre.
»The positional stance acknowledges the existence of empirical truths, values and knowledge, and also their contingency.« (S. 880)
Aber Wahrheiten im Sinne von bloßen Fakten haben aus unterschiedlicher Perspektive verschiedene Bedeutung. Eine wichtige Perspektive ist natürlich diejenige betroffener Frauen. Die Konsequenz liegt auf der Hand. Der Suche nach einem objektiven Dritten muss die Konfrontation verschiedener Perspektiven vorausgehen. Klar, dass nach Meinung Kochers die feministische Perspektive dabei größere Beachtung verdient. Wo es angezeigt ist, soll Herr Mustermann durch Frau Mustermann ersetzt werden oder auch beide zu Wort kommen. Schade nur, dass Kocher kein handfestes Beispiel liefert.
Friederike Wapler (Politische Gleichheit: Demokratietheoretische Überlegungen, S. 427-455) setzt sich mit der Frage auseinander, wie feministische Repräsentationsforderungen demokratietheoretisch eingeordnet werden können. Konkret geht es dabei natürlich in erster Linie um Frauenquoten. Wapler bietet eine hilfreiche, ausgewogene Darstellung. Am Ende hält sie verbindliche Quotenregelungen jedenfalls für allgemeine politische Wahlen für problematisch. Die Problematik würde noch deutlicher, wenn man alle Gruppen, Minoritäten usw. usw. Revue passieren ließe[15], die Repräsentationsforderungen stellen könnten.
Elisabeth Holzleithner (Geschlecht als Anerkennungsverhältnis. Perspektiven einer Öffnung der rechtlichen Kategorie im Zeichen des Prinzips gleicher Freiheit, S. 457-485) referiert und reflektiert den Diskurs, der dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Geburtenregister vorausgegangen ist. Dabei stellt sie neben der deutschen auch die österreichische Diskussion heraus. Das ist sicher für alle, die daran beteiligt oder engagiert waren, wichtig. Dem Beobachter erscheint der Beschluss des BVerfG heute allerdings dank der langen Bemühungen feministischer und queeraktivistischer Juristen so selbstverständlich, dass ihn die Geschichte nicht mehr wirklich interessiert. Allenfalls die Konsequenzen des Beschlusses können noch einmal für Aufregung sorgen, wenn sich die queerfeministische Forderung durchsetzen sollte, ganz auf einen Geschlechtseintrag im Geburtenregister zu verzichten. Holzleithner hält diese Lösung zwar für vorzugswürdig, aber sie akzeptiert, dass auch Mann, Frau und Andere ihre Geschlechtsidentität im Geburtsregister anerkannt wissen möchten.
Theresia Degener schließlich (Die UN Behindertenrechtskonvention – Ansatz einer inklusiven Menschenrechtstheorie, S. 488-508) gibt einen informativen Überblick über die UN-Behindertenkonvention und betont dabei die Parallelität der Disability Studies mit dem feministischen Konstruktivismus. Ihre Darstellung fordert die Auseinandersetzung mit dem feministischen Dogma von dem Dilemma der Differenz (Minow[16]) und der Tabuisierung von Natürlichkeits- und Normalitätsdiskursen heraus. Diese Auseinandersetzung würde hier aber zu weit führen. Hier sei nur angemerkt, dass rechtliche Anerkennung, wie sie Holzleithner vorschwebt, nicht ohne Bezeichnung der Differenz zu haben ist.
Mit Rücksicht darauf, dass Degener als Professorin an der Evangelischen Fachhochschule in Bochum tätig ist, mag es von Interesse sein, dass jedenfalls im benachbarten Gelsenkirchen, die Annahme der Disability Studies, Behinderung sei nur die Abweichung von einer sozial konstruierten Normalität, schwer zu vermitteln sein dürfte. In Gelsenkirchen wurden im Sommer drei Kinder geboren, bei denen an einer Hand keine Finger ausgebildet waren. Der Normalitätsdiskurs[17] beruft sich heute gerne auf Georges Canguilhem. Dessen »These, daß es an sich und a priori keine ontologische Differenz zwischen gelungenen und verfehlten Gebilden des Lebens gibt«[18], besagt aber weniger und anderes, als hineingelegt wird. Mit »gelungen« und »verfehlt« enthält sie zwei normative Ausdrücke, die ihren Gehalt relativieren. Unter Fehlbildungen oder anderen Behinderungen leiden Kinder und ihre Eltern. Niemand wird deshalb den Wert der Kinder als Menschen in Frage stellen. Canguilhem spricht bei solchen Fehlbildungen von Anomalien. Selten beeinträchtigen sie die Lebensfähigkeit des Individuums. Noch seltener erweisen sie sich als evolutionär. Ob eine Anomalie pathologisch ist, hängt, jedenfalls bei Menschen, davon ab, ob sie subjektiv darunter leiden und deshalb Therapie suchen. Insoweit gibt es freilich Rückkopplungsprozesse, bei denen Normalität ins Spiel kommt. Was als belastend empfunden wird, kann sich dem Betroffenen aus einem Vergleich mit anderen, aber auch aus Therapieangeboten erschließen. Aber wie gesagt, das Thema ist zu groß, um es hier nebenher zu behandeln.
___________________________________________________________
[1] Martha Fineman, Introduction: Feminist and Queer Legal Theory, in: Martha Fineman u. a. (Hg.), Feminist and Queer Legal Theory, Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations, London 2009, S. 1-6.
[2] Mitstreiterin MacKinnons war insoweit Andrea Dworkin (Pornographie [Pornography, 1979], Männer beherrschen Frauen, Köln 1987).
[3] Judith Lorber, The Variety of Feminisms and their Contributions to Gender Equality, [Electronic ed.], Oldenburg 1997, S. 16
[4] Dazu auf Rzozblog Bourdieus Diagnose männlicher Herrschaft bei den Kabylen als normativer Rückschaufehler.
[5] Das ist Thema eines Vortrags, den ich für die Tagung »Organisierte Interessen und Recht, organisierte Interessen im Recht«, am 28./29. November 2019 in Bochum vorbereitet habe. Das Manuskript stelle ich auf Anforderung gerne zur Verfügung.
[6] Martha Fineman, Introduction: Feminist and Queer Legal Theory, in: Martha Fineman u. a. (Hg.), Feminist and Queer Legal Theory. Intimate Encounters, Uncomfortable Conversations, London 2009, S. 1-6.
[7] Stefan Hirschauer, Wozu »Gender Studies«? Geschlechtsdifferenzierungsforschung zwischen politischem Populismus und naturwissenschaftlicher Konkurrenz, Soziale Welt 54, 2003, 461-482, S. 463.
[8] Gesine Fuchs/Sabine Berghahn, Recht als feministische Politikstrategie?, Femina Politica 2012/2, 10-24, S. 11.
[9] Susanne Baer, Objektiv—neutral—gerecht? Feministische Rechtswissenschaft am Beispiel sexueller Diskriminierung im Erwerbsleben, Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 77, 1994, 154-178, S. 157.
[10] Klaus F. Röhl, Theodor Geiger, Bemerkungen zur Soziologie des Denkens, ARSP XLV, 1969, 23-52, in: Annette Brockmöller (Hg.), Hundert Jahre Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2007, S. 149-165.
[11] So eine These von Eric Hilgendorf, Die Renaissance der Rechtstheorie zwischen 1965 und 1985, 2005.
[12] Die Metapher stammt von Donna Haraway, auf die Kocher sich für die »Situiertheit« des Richterwsissens beruft: »… the god trick of seeing everything from nowhere … « (Donna Haraway, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, Feminist Studies 14, 1988, 575-599, S. 581).
[13] Der Ausdruck taugt als Übersetzung des englischen positionality eigentlich nicht, denn Hellmuth Plessner hat ihn für seine Anthropologie als exzentrische Positionalität belegt.
[14] Katharine T. Bartlett, Feminist Legal Methods, Harvard Law Review 103, 1989, 829-888, S. 880ff.
[15] So in einer Glosse »Frauenquote – Fraktur« am 2. 11. 2019 in der FAZ, gezeichnet mit dem Kürzel »tifr« (Timo Frasch).
[16] Martha Minow, Making All the Difference: Three Lessons in Equality, Neutrality, and Tolerance, DePaul Law Review 1, 1989, 1-13; dies., Making All the Difference. Inclusion, Exclusion, and American Law, Ithaca 1990, S. 19ff.
[17] Jürgen Link, Normal/Normalität/Normalismus, in: Karlheinz Barck/u. a. (Hg.), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, 2010, Bd. 7, S. 538-562.
[18] Georges Canguilhem, Das Normale und das Pathologische [Le normal et le pathologique, Paris 1943], 1974, S. 12.
Ähnliche Themen