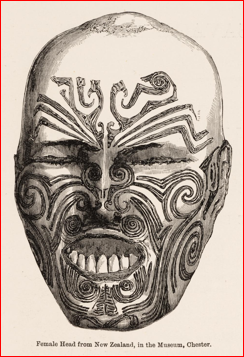Das »Recht als Gegenstand der Ästhetik« ist zum Thema geworden.[1] Da liegt es nahe zu fragen: Handelt es sich um eine rechtlich oder auch nur moralisch relevante Diskriminierung, wenn ein Vermieter unter zwei Interessenten den auswählt, der ohne Tattoos daher kommt und eher nach seinem Geschmack gekleidet ist? Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor vielen Jahren einmal einen Studenten, der sich um eine Hilfskraftstelle beworben hatte, zurückgewiesen habe, weil ich den Anblick eine gepiercten Mannes nicht ertragen wollte. Darf man öffentlich oder privat bestimmte Verhaltensweisen »geschmacklos« nennen, etwa bestimmte Sexualpraktiken? Bei aller Menschenliebe gibt es doch Zeitgenossen, die man nur mit der Zange anfassen möchte (solange sie nicht in Not sind).
Die Sache ist problematisch, weil das Geschmacksurteil weithin durch Normalitätsvorstellungen geprägt ist, solche Vorstellungen aber vielfach Minderheiten diskriminieren. Zumal Rassismus hat wohl eine starke »ästhetische« Komponente. Nicht nur Minderheiten, auch Frauen sind von negativen Geschmacksurteilen, nicht zuletzt durch ihre Geschlechtsgenossinnen, eher betroffen als Männer, weil sie allgemein körperbetontere Kleidung tragen und darüber hinaus um ihr Erscheinungsbild mehr oder jedenfalls augenfälliger bemüht sind, so dass auch häufiger Missgriffe zu verzeichnen sind, etwa stämmige Beine auf superschlanken Stilletos, die sich fast täglich im Fernsehen bestaunen lassen.
Es lässt sich sicher darüber diskutieren, ob solche Geschmacksurteile die Auszeichnung als ästhetisch verdienen. Zur Hälfte beruhen sie auf Tradition und Gewohnheit. Ein Christ, der seine Kirche liebt und sich selbst beobachtet, wird feststellen, dass die Liebe viel mit ästhetischen Qualitäten zu tun hat, mit historischen Kirchenräumen, mit vertrauten Texten, mit Chorälen und Kirchenmusik, kurz mit Farben, Formen und Klängen, und so er katholisch ist, auch mit Gerüchen, die ihm seit der Kindheit vertraut sind. Er wird seine Kirche mit dem vergleichen, was er vom Islam hört, sieht und riecht. Natürlich kennt und schätzt er von Reisen und aus Museen, aus Büchern und von Bildern die wunderbare Architektur, Ornamentik und Kalligraphie des mittelalterlichen Islam. Doch was er in seiner deutschen Umgebung wahrnimmt, dürfte seine Sinne kaum ansprechen. Ein Besuch in der großen Moschee in Duisburg-Marxloh ist eine ästhetische Enttäuschung. Die neobyzantinische Architektur mag noch hingehen, aber die Dekoration wirkt schablonenhaft, die Farben stammen anscheinend aus dem Baumarkt und der Geruch ist jedenfalls kein Weihrauch. Ist dieser Eindruck ein Ausdruck von Islamophobie?
Schönheit macht erfolgreich und glücklich.[2] Schöne Menschen erzielen materielle und immaterielle Vorteile. Ihr Aussehen wird nicht nur auf dem Partnermarkt honoriert, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt, und sie steigert direkt und indirekt das Wohlbefinden. In der Gleichheitsdiskussion wagt man sich an Schönheit als diskriminierenden Faktor nicht heran, weil er bis zu einem gewissen Grade als naturgegeben und nicht gesellschaftspolitisch beeinflussbar gilt. Aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters, und so ist diese Enthaltsamkeit[3] im Zeitalter des Konstruktivismus eher überraschend.
Es besteht wohl kein Zweifel, dass professionelles Verhalten gegenüber anderen Menschen nicht von ästhetischen Differenzierungen geleitet werden darf. Juristische Auslegungskunst hätte keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, ästhetische Differenzierungen als Diskriminierung zu ächten, wenn sie zu Benachteiligungen im Anwendungsbereich des § 2 AGG führen. Fehlende körperliche Schönheit ließe sich als Behinderung interpretieren. Ästhetisch abgelehnte Verhaltensweisen werden sich oft als unerwünschte Verhaltensweisen im Sinne von § 3 III AGG einordnen lassen.
Eigentlich wollte ich hier für die Freiheit des ästhetischen Urteils auch über Menschen und ihre Verhaltensweisen plädieren. Aber nun befürchte ich, dass ich mich damit auf ein Minenfeld begeben habe. Vielleicht meldet sich ja ein Minenräumer.
Als Fortsetzung dieses Eintrags ist zu lesen Ästhetische Diskriminierung – heute mit JURIS und Bourdieu.
Nachtrag: Ältere, immer noch gute Literaturzusammenstellung: Jürgen Maes, Physische Attraktivität – eine gerechtigkeitspsychologische Frage, GiP-Bericht Nr. 139, 2001. Zu Fn. 2: Lesenswert im Tagesspiegel vom 9. 10. 2016 der Artikel Lookismus: Bevorzugung des Schönen.
Nachtrag vom 11. 4. 2021: Dazu heute in der FamS ausführlich und gut: Justus Binder, Ugly Lives Matter. Bender wiegelt allerdings ab. Das Problem sei nach Auskunft aller Fachleute unlösbar, denn es handele sich nicht um die strukturelle Diskriminierung einer Gruppe, sondern um ein jeweils individuelles Problem. Dass es sich um ein individuelles, nicht an Gruppenmerkmalen festzumachendes Problem handle, stimmt allerdings nicht damit überein, dass Bender zuvor Untersuchungen anführt, nach denen das Schönheitsurteil über Individuuen bei verschiedenen Beobachtern einhellig ausfällt:
»Außenstehenden wurden Fotos der Kinder gezeigt. Sie waren erbarmungslos einig, welches Kind auf einer Skala von 0 bis 6 hübsch war und welches nicht.«
Wenn man tatsächlich der Ansicht ist, dass das Problem sich nicht gesetzgeberisch lösen lässt, wie der von Bender zitierte FDP-Politiker – eine Ansicht, die ich teile –, dann ist als Konsequenz wohl auch bei anderen »strukturellen« Diskriminierungen mehr Zurückhaltung geboten. Auf der anderen Seite gilt es, Funktionäre, die Chancen verteilen oder entziehen wie Lehrer und Richter für ihre »Vorurteile« zu sensibilisieren.
Zum Thema: Lea Geißendörfer u. a., Die Schönheitsprämie von Politikern im Amt, ifo Schnelldienst, 2023, 76, Nr. 12, 28-31.
__________________________________
[1] Helge Dedek, Die Schönheit der Vernunft – (Ir-)Rationalität von Rechtswissenschaft in Mittelalter und Moderne, Rechtswissenschaft 1, 2010, 58-85; Rolf Gröschner, Judiz – was ist das und wie läßt es sich erlernen?, Juristenzeitung 1987, 903-908; Hans Robert Jauß, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, 1991; Michael Kilian, Vorschule einer Staatsästhetik, Zur Frage von Schönheit, Stil und Form als – unbewältigter – Teil deutscher Verfassungskultur im Lichte der Kulturverfassungslehre Peter Häberles, FS Häberle, 2004, 31-70; Joachim Lege, Ästhetik als das A und O »juristischen Denkens«, Rechtsphilosophie (RphZ) 1, 2015, 28-36; Edward M. Morgan, The Aesthetics of International Law, Toronto 2007; Gerhard Plumpe, Eigentum – Eigentümlichkeit. Über den Zusammenhang ästhetischer und juristischer Begriffe im 18. Jahrhunert, Archiv für Begriffsgeschichte 23, 1979, 175-196; Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, § 14: Ästhetik des Rechts (in der 5. Aufl. von 1956 S. 205-208); Andreas Reckwitz u. a. (Hg.), Ästhetik und Gesellschaft. Grundlagentexte aus Soziologie und Kulturwissenschaften, 2015; Klaus F. Röhl, Zur Rede vom multisensorischen Recht, Zeitschrift für Rechtssoziologie 33, 2012/2013, 51-75; Pierre J. Schlag, The Aesthetics of American Law, Harvard Law Review 115, 2002, 1047-1118; Eva Schürmann, Das Recht als Gegenstand der Ästhetik?, Rechtsphilosophie (RphZ) 1, 2015, 1-12; Arno Scherzberg u. a. (Hg.), Kluges Entscheiden, 2006; Heinrich Triepel, Vom Stil des Rechts. Beiträge zu einer Ästhetik des Rechts (1947) mit einer Einleitung von Andreas von Arnauld und Wolfgang Durner (S. I-XLII), 2007; Cornelia Vismann, Das Schöne am Recht, 2012.
[2] Daniel S. Hamermesh/Jason Abrevaya, Beauty Is the Promise of Happiness?, IZA Discussion Paper No. 5600, 2011.
[3] Gesucht habe ich u. a. in dem Heft 2/2016 der Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Aber auch dort habe ich den Suchbegriff »ästhetisch« nur in dem Artikel von Ansgar Thiel u. a. über »Körperlichkeit als Devianz. Zur sozialen Konstruktion des übergewichtigen Körpers und ihrer Folgen« (S. 37-48) gefunden. Dort heißt es (S. 39), insbesondere die »Bildsprache der Fitnessbewegung der 1970er und 1980er Jahre habe ein ästhetisches Element« in den Diskurs eingebracht.
Ähnliche Themen