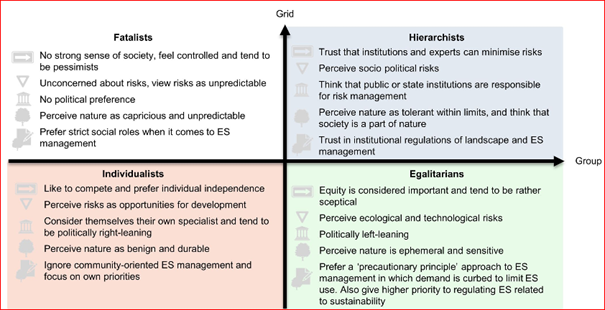Der Aristotelische Naturalismus will Natürlichkeitsargumente wieder hoffähig machen.[1] Zu einiger Prominenz hat es Philippa Foot gebracht. So hatte ich einige Hoffnung auf ein gutes Ende des Natural Turn in ihre 2001 erschienene Abhandlung »Natural Goodness« gesetzt.[2] Die Hoffnung wurde geweckt, weil Foot die »Lebensform« der Spezies Mensch zur Basis ihres Naturalismus macht. Auf den ersten Blick bietet sie damit eine anthropologisch begründete Ethik. Doch, wie so oft, der erste Blick täuscht.
In dem von Thomas Hoffmann und Michael Reuter herausgegebenen Sammelband »Natürlich gut« mit »Aufsätzen zur Philosophie von Philippa Foot« (2010) wird einige Kritik geübt. Aber die Zustimmung oder gar Bewunderung überwiegt. Zwei Kritikpunkte bleiben unterbelichtet, die Zirkularität des Arguments[3] und die Lücke, die der Sprung von der subrationalen ersten Natur des Menschen zu seiner zweiten kulturellen Natur hinterlässt[4]. An diesen beiden Kritikpunkten will ich meine Enttäuschung festmachen.
Foot will »über etwas schreiben, das man ›natürliche Qualität und natürlichen Defekt bei Lebewesen‹ (natural goodness and defect in living things) nennen kann« (S. 18). Sie verankert ihren ethischen Naturalismus in der Natur des Menschen, indem sie dessen Fähigkeit, sich an Gründen zu orientieren, als wesentliches Merkmal seiner »Lebensform« postuliert. Diese Fähigkeit nennt sie praktische Rationalität. Normative Urteile im eigentlichen Sinne fordern ein in irgendeiner Weise durch Willen und Verstand gelenktes Verhalten ein, wie es nur dem Menschen möglich ist. Menschen verfügen, wie schon die meisten Tiere, über soziale Fähigkeiten. Sie haben darüber hinaus ein Selbstbewusstsein, dass ihnen zu intellektuellen Fähigkeiten verhilft, darunter die auch die Empfänglichkeit für Gründe. »Denn das Handeln nach Gründen ist eine grundlegende Weise menschlichen Verhaltens.« (S. 36) Es ist »Tatsache, daß Menschen Wesen mit der Fähigkeit sind, Handlungsgründe anzuerkennen und entsprechend zu handeln« (S. 43). Unzugänglichkeit für Gründe gilt Foot als natürlicher Defekt. Somit gehört praktische Rationalität zur Natur des Menschen.
Für das Konzept der Lebensform bezieht sich Foot (S. 46ff) ausführlich auf einen Aufsatz von Michael Thompson[5] – und weckt dadurch die Hoffnung auf eine anthropologische Grundlegung. Michael Thompson hat den Begriff der Lebensform ausgearbeitet. Er meint, die üblichen Definitionen des Lebens mit einer Liste von »Merkmalen des Lebendigen«[6] bildeten eine stabile Einheit, so dass man in einen Zirkel gerate, wenn man eines von ihnen separat zu erläutern versuche. Leben zeige sich nicht im Abstrakten, sondern werde nur in lebendigen Individuen wirklich. Zwischen dem abstrakten Begriff des Lebens und dem konkreten Individuum steht die Spezies (Gattung, Art), die Thompson »Lebensform« nennt. Über die Lebensformen lassen sich daher allgemeine Aussagen machen[7]. Hinsichtlich solcher Aussagen über die Spezies oder Lebensform spricht Thompson von naturhistorischen Urteilen (natural-historical judgements). Diese Benennung leitet er von Aussagen ab, wie man sie typisch in Wander- und Naturführern findet, wenn es dort etwa heißt: Hier leben Rotluchse. Die Fellfarbe der Körperoberseite reicht von blassgelb bis rötlich braun. Im Frühling bringt der weibliche Rotluchs zwei bis vier Junge zur Welt. Später lernen die Jungen, Kaninchen, Hasen und andere Kleintiere zu jagen[8]. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Allsätze, denn die Aussage muss nicht auf jedes Exemplar der Gattung zutreffen, sondern um Urteile über typische Eigenschaften, die auch dann »wahr« sind, wenn sie nicht bei allen Individuen zutreffen. Man hat auch schon Rotluchse mit schwarzem Fell gefangen.
Thompson verwendet einigen Aufwand darauf zu begründen, dass Aussagen über eine Lebensform allgemeingültige Urteile sind, wiewohl sie nicht auf jedes Exemplar der Gattung zutreffen. Dazu bemüht er insbesondere die Kategorienlehre des Aristoteles. Diese Bemühungen laufen darauf hinaus, dass sich Lebensformen durch typische Eigenschaften und Prozesse auszeichnen, mit einem anderen Ausdruck, durch Normalität.
Spannend wird Thompsons Gedankengang durch die anschließende Frage, ob naturhistorische Urteile, also allgemeine Aussagen über eine Spezies oder Lebensform, normativer Art sind[9]. Seine Antwort schillert, ist aber doch letztlich negativ. Naturhistorische Urteile scheinen jedoch einen »verborgenen normativen Unterbau«[10] zu haben. Sie liefern die Maßstäbe oder Standards für die Exemplare der Gattung. Der Züchter wird ein Pferd nach seinem Körperbau als wohlgebildet und geeignet für den Rennsport einstufen, der Kenner eine Rose als besonders schönes Exemplar ihrer Gattung. Von einer Katze mit drei Beinen könnte man sagen, sie sei defekt, von einer Pflanze, die wuchert, sie sei krank. Mit solchen Aussagen werden normative Kategorien, die eigentlich nur menschlichem Verhalten gelten, auf die subrationale Natur angewendet. Normalität, Anormalität und Anomalien = »natürliche Defekte« sind stets »lebensformrelativ«. Dabei handelt es sich zwar um »künstliche Kategorien«[11]. Aber letztlich sind alle Begriffsbildungen künstlich. »Naturhistorische Urteile«, welche die Lebensform einer Spezies beschreiben, seien deshalb nicht normativ.
Foot entwickelt an Hand der Lebensformen ein Konzept »natürlicher Normen« (S. 44ff).
»In meiner Sicht steht moralische Bewertung nicht im Gegensatz zur Tatsachenbehauptung, sie hat vielmehr mit Tatsachen einer besonderen Art zu tun – genauso wie Bewertungen solcher Dinge wie Sehvermögen und Geör bei Tieren sowie anderer Aspekte ihres Verhaltens. Ich denke, niemand würde etwas anderes als eine Tatsache darin sehen, daß mit dem Gehör einer Glucke etwas nicht in Ordnung ist, die das Schreien ihres eigenen Kükens nicht ausmachen kann – ebenso wie mit dem Sehvermögen einer Eule, die im Dunkeln nicht sieht. Nicht weniger offensichtlich ist es, daß es Bewertungen gibt, die auf der Lebensform unserer eigenen Spezies basieren – Bewertungen des Sehvermögens von Menschen, ihres Gehörs und Gedächtnisses, ihrer Konzentration usw. die objektiv sind und Tatsachen zum Ausdruck bringen. Warum scheint es dann so abwegig, daß sich auch die Bewertung des menschlichen Willens an Tatsachen der menschlichen Natur und des Lebens unserer Spezies orientieren muß?« (S. 42f)
Was natürlich gut ist, ist für jede Spezies verschieden. Nur die formale Struktur der Bewertung bleibt gleich (S. 72). Die Analogie lautet dann, »daß Menschen darauf angewiesen sind, daß Moral vermittelt und befolgt wird« (S. 33), ähnlich »wie die Bienen auf Stacheln« (S. 66; ein Vergleich, der auf Peter T. Geach zurückgeht). Offen bleibt damit zunächst die Frage nach dem Inhalt von Moral oder Tugend.
Natürliche Normen kommen nur Lebewesen zu. Sie ergeben sich aus »aristotelischen Kategorien«, das sind solche Eigenschaften einer Spezies, die »unmittelbar oder mittelbar, mit Selbsterhaltung (zum Beispiel durch Verteidigung oder Nahrungsaufnahme) oder mit der Fortpflanzung des Individuums (wie beim Nestbau) zu tun haben« (S. 51). Es geht um Aussagen, »die mit der Teleologie der Lebewesen[12] dieser Art zu tun haben« (S. 51). Daraus werden Normen abgeleitet, die von einem Exemplar der betreffenden Spezies sagen, »daß es (dieses Individuum) so ist wie es sein sollte, oder aber, daß es in einer bestimmten Hinsicht mehr oder weniger defekt ist« (S. 54).
»Die Frage ist also, ob Eigenschaften und Vollzüge von Menschen in Bezug auf ihre Rolle im menschlichen Leben gemäß dem Schema der natürlichen Normativität bewertet werden können, das wir bei Pflanzen und Tieren entdeckt haben.« (S. 61)
An dieser Stelle ist die Frage nur noch rhetorisch, war sie doch zuvor schon positiv beantwortet worden. Nun ist man gespannt, aus welchen »Eigenschaften und Vollzüge von Menschen« natürliche Normen abgelesen werden sollen.
»Begrifflich wird die Qualität von Eigenschaften und Vollzügen durch den spezieseigenen Bezug auf Überleben und Fortpflanzung bestimmt; denn nichts anderes als Überleben und Fortpflanzung nach der Art der jeweiligen Spezies ist das Gute in der botanischen und zooologischen Welt. An diesem Punkt kommen die Fragen ›Wie?‹, ›Warum?‹ und ›Wozu?‹ An ein Ende. Das ist natürlich anders, wenn wir uns mit Menschen beschäftigen. … Die Teleologie des Menschen erschöpft sich nicht im Überleben allein.« (S. 64f).
Da würde man gerne zustimmen. Doch wo bleibt die Natur? Aristotelisch notwendig sei, was für Gutes erforderlich sei (S. 68). Aber was ist das menschlich Gute, wenn es nicht bloß in Selbsterhaltung und Fortpflanzung besteht und die Bewertung menschlichen Handelns »dieselbe begriffliche Struktur hat wie die Bewertung von Vollzügen in der sub-rationalen Welt des Lebendigen« (S. 72)?. Die »Lebensform« einer Spezies zeigt sich nicht in einer Momentaufnahme, sondern in der »Naturgeschichte«.
»Es gibt wahre Aussagen wie ›Menschen machen Kleider und bauen Häuser‹, die sich vergleichen lassenmit ›Vögel haben federn und bauen Nester‹. Und so gibt es auch Aussagen wie ›Menschen führen Regeln ein und erkennen Rechte an‹.« (S. 75).
Regeln und Recht mit welchem Inhalt? Der Inhalt ergibt sich nicht aus biologischen und psychischen Merkmalen des Menschen, sondern aus seiner Rationalität, von der Foot zeigen will, »daß es Merkmale gibt, die all den Bewertungen gemeinsam sind, die man ›Bewertungen des rationalen Willens des Menschen‹ nennen kann« (S. 96). Dazu erfahren wir, wie praktische Rationalität arbeitet, vor allem, dass sie keinen Unterschied macht zwischen moralischen und anderen Vernunfturteilen. Foot zitiert das harm principle John Stuart Mills, nachdem nur solche Handlungen moralischer Beurteilung zugänglich sind, die sich auf andere Menschen oder die Gesellschaft negativ auswirken, und erklärt, dass bloß törichte oder selbstzerstörerische Handlungen nach der gleichen Logik bewertet werden. Wenn Rationalität nicht zu Ergebnissen gelangt, die nach der Vorstellung Foots rational sind, ist sie mit einem natürlichen Fehler behaftet.
In welche Richtung der »rationale Wille des Menschen« führen müsste, um nicht als fehlerhaft zu gelten, zeigt das 6. Kapitel, nämlich zu »Glück und Wohl« des Menschen. Das eigentliche, »tiefe« Glück findet Foot nach dem Vorbild des Aristoteles in tugendmäßiger Betätigung – im Gegensatz zu trivial kindlicher Zufriedenheit oder gar dem Lustgewinn aus boshaftem Verhalten. So gerne der Leser diesen Überlegungen zustimmen möchte, so sehr muss er bezweifeln, dass es sich insofern um eine kulturelle Universalie handelt, die als natürliche Lebensform des Menschen gelten kann. Wenn das Streben nach »Glück und Wohl« in diesem höheren Sinne zur natürlichen Lebensform des Menschen gehörte, wären Moralphilosophie und Ethik wohl überflüssig.
Das Buch endet mit einem lesenswerten Kapitel über Immoralismus, wie ihn Platon dem Sophisten Thrasymachos in den Mund legt und wie ihn Nietzsche als eigene Überzeugung verkündet. Hier erfahren wir, dass reine Freundschaft, echte Barmherzigkeit und wahre Liebe zur Gerechtigkeit natürliche Qualitäten der Spezies Mensch bilden.
»Wenn Nietzsche bestritt, daß Handlungsbeschreibungen wie ›Verletzung‹, ›Unterdrückung‹ ›Vernichtung‹ usw. notwendig einen Widerspruch zur Tugend der Gerechtigkeit – ungerechtes Handeln – signalisieren, daß also derartige Handlungen moralisch als solche falsch seien, dann gab es dafür keine stimmige psychologische Grundlage. Seine Auffassung ist meines Erachtens völlig verkehrt und zudem gefährlich. Selbstverständlich widerstreitet sie den Prinzipien der natürlichen Normativität, wie sie in diesem Buch erläutert wurden.« (S. 148)
Um Nietzsche die »psychologische Grundlage« abzusprechen, muss man wohl von der Vorstellung von psychischen und moralischen Grundintentionen ausgehen. Das wäre aber gerade der psychologische Naturalismus, den Foot vermeiden will. Ihr Naturalismus ist indirekter. Er wird durch die praktische Rationalität vermittelt, die zur Lebensform des Menschen gehört. Doch diese Vermittlung läuft auf einen Zirkelschluss hinaus. Praktische Rationalität, wie sie Foot versteht, ist mehr als bloße Reflexivität. Sie hebt den struggle of life nicht nur technologisch auf die Ebene der Zweck-Mittel-Rationalität, sondern verhilft ihm zugleich zu moralischen Schutzvorkehrungen. Foots praktische Rationalität orientiert sich definitionsgemäß an Handlungszielen, die etwas Gutes für den Menschen darstellen.[13] Oder in (unkritisch gemeinten) Formulierungen von Pauer-Studer: Praktische Rationalität richtet sich nach den Bedingungen der Moral: »In Natural Goodness reduziert Foot praktische Rationalität auf eine Konzeption guter Gründe, die von den Tugenden her vorgegeben werden.«[14]. Foots praktische Vernunft ist von vornherein eine werthaft verfasste Vernunft. So wird in die Lebensform des Menschen hineingelegt, was danach als natürliche Normativität herausgeholt wird.
Foots Naturalismus ist nicht nur zirkelhaft, sondern auch inkonsequent, sozusagen ein halbierter Naturalismus, halbiert, weil der immer wieder angestellte Vergleich mit den Lebensformen von Pflanzen und Tieren nicht durchgehalten wird. Der Sprung von der subrationalen ersten Natur zur praktischen Rationalität lässt eine Lücke. Die Analogie zu pflanzlichen und tierischen Lebensformen bleibt unvollständig, wenn Rationalität als einziges Merkmal herausgegriffen wird. Damit lässt Foot alle Probleme hinter sich, die daraus folgen, dass der Mensch nicht nur Geist, sondern auch Leib ist. Diese Lücke wird indirekt von Anton Leist angesprochen:
»Wenn man … nur die Bedeutung des logos für eine zweite, eben kulturell herausgearbeitete menschliche Natur betont, übersieht man leicht die nötigen biologischen Voraussetzungen für diese zweite Natur.«[15]
Um die Lücke zu schließen, müsste man die empirische Anthropologie zu Rate ziehen. Deren Minimalaussage wäre wohl: Die Lebensform des Menschen unterscheidet sich von der tierischen wohl dadurch, dass alle Handlungen, die der Lebenserhaltung und Fortpflanzung dienen, ihren Weg durch das Bewusstsein nehmen können und damit praktischer Rationalität zugänglich sind. Doch damit ist die Biologie nicht abgeschafft. Menschliches Gedeihen gibt es nur in der Verbindung von Körper und Geist. Zur Lebensform des Menschen gehören unabdingbar unter anderem die Heterosexualität und historisch vielleicht auch der Kleinstamm und/oder die Kleinfamilie.[16] Foot weist solche Gedanken gleich zu Beginn zurück, indem sie sich dagegen verwahrt, der Lebensform des Menschen eine bestimmte Sexualmoral zu entnehmen, indem sie sagt:
» …that by natural goodness I emphatically do not mean the goodness thought by many to belong for instance, to some but not other sexual practices because some but not others are ›natural‹.« (2001 S. 3 = 2014 S. 18).
Dieser Vorbehalt wird für den Leser um so unverständlicher, je länger er liest, wird er doch geradezu »emphatisch« mit natürlichen Lebensformen konfrontiert. Die ständige Bezugnahme auf solche Lebensformen fordert dazu heraus, die Möglichkeit eines normativen Rekurses auf die subrationale erste Natur jedenfalls zu bedenken, so wie es heute selbstverständlich ist, wenn menschliches Verhalten gegenüber der außermenschlichen Natur in Rede steht. Foot und Thompson richten sich zwar an philosophische Fachkollegen. Sie müssen aber damit rechnen, dass auch unbedarfte Juristen, die einen Alltagsnaturalismus mitbringen, ihre Texte lesen. Juristen könnten Foot etwa mit der Frage konfrontieren, ob eine Verfassungsbeschwerde gegen den 2017 geänderten § 1353 I 1 BGB moralisch zulässig oder gar geboten wäre. Gefordert ist deshalb eine Erklärung, was genau den moralischen Rekurs auf natürliche Lebensformen einschränkt oder gar blockiert. Die Antwort, die Foot geben könnte, liegt nahe: Die Empfänglichkeit für Gründe führt zu der Überzeugung, dass die relevante Gleichheit zwischen Menschen stärker ist als alle Abweichungen von einer typischen Lebensform. Wenn es um Moral und Recht geht, ist der Gleichheitssatz stärker als die subrationale Natur. Wenn also Heterosexualität die typische »Lebensform« des Menschen sein sollte, folgte daraus keine Sexualmoral. Homosexualität und Transsexualität sind und bleiben Teil der Natur des Menschen, auch wenn sie aus der »Lebensform« herausfallen. Die Möglichkeit der Reflexion über biologische Funktionalität macht es möglich, Sexualität von der Reproduktionsfunktion gedanklich und dann auch praktisch zu trennen. Deshalb mag man z. B. Menschen, die sich gegen eigene Kinder entscheiden, aus anderen Gründen loben oder tadeln, man kann ihnen aber jedenfalls keinen Verstoß gegen die Natur vorwerfen. Ich würde aber nicht so weit gehen, die rechtliche Privilegierung der Bio-Ehe, wie sie in vielen Staaten noch immer Gesetz ist und wie sie zum Programm einiger politischer Parteien auch in Europa gehört, als Menschenrechtsverletzung oder umgekehrt als naturrechtlich fundierte Forderung einzuordnen. Diversität ist auch für politische Programme angesagt.
Was bleibt für den Natural Turn? Ein weitergehender Naturalismus kommt nur für solche Urteile in Betracht, die keine Verbindlichkeit für Dritte beanspruchen. In diesem Sinne steht es jedem frei, bewusst für natürlich gehaltenen Lebensformen nachzuleben, und zwar durchaus auch im Verein mit anderen. Man wird es auch für zulässig halten können, dass Menschen, so wie sie sich für Bio-Lebensmittel entscheiden, Bio-Lebensformen bevorzugen, sich für Bio-Sex, Bio-Ehe und Bio-Familie einsetzen und Reproduktionsmedizin und Human Enhancement ablehnen, so wie andere gentechnisch veränderte Lebensmittel ablehnen. Auch ein Bio-Feminismus, der als Differenzfeminismus für die Geschlechter unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft sieht, ist solange vertretbar, wie er beschreibend »Glück und Wohl« der Betroffenen in den Blick nimmt, ohne einen Lebensstil vorzuschreiben oder gar rechtliche Einschränkungen zu akzeptieren.
Nachtrag: Eine in ihrer Ausführlichkeit kaum noch lesbare Stellungnahme von Richard Friedrich Runge, Eine kritische Theorie der Tugendethik, 2022, ist im Internet frei zugänglich (Campus Wissenschaft).
[1] Vgl. Christian Kietzmann, Ethik und menschliche Natur. Literatur zum Aristotelischen Naturalismus, Philosophische Rundschau 65, 2018, 175-196. Einen neueren Sammelband (Martin Hähnel (Hg.), Aristotelian Naturalism. A Research Companion, 2020) habe ich nur durchgeblättert.
[2] Deutsche Übersetzung von Michael Reuter: Die Natur des Guten, 2004. Ich zitiere nach der Suhrkamp-Taschenbuch-Ausgabe von 2014 (Seitenzahlen in Klammern im Text).
[3] Dem Einwand der Zirkularität am nächsten kommt Gerlinde Pauer-Studer, wenn sie Foot vorhält, sie könne »nicht beides behaupten: dass zum einen Verletzungen der Zweck-Mittel-Effektivität ein allgemeines Rationalitätsdefizit sind und dass zum anderen praktische Rationalität nicht zweckneutral ist« (S. 182).
[4] Den Einwand der Lücke zur anthropologischen Basis hat Anton Leist im Blick: Naturalismus bei Foot und Hursthouse, in: Thomas Hoffmann/Michael Reuter (Hg.), Natürlich gut, 2010, 121-148.
[5] Michael Thompson, The Representation of Life, in: Rosalind Hursthouse u. a. (Hg.), Virtues and Reasons 1995, 247-296. Überarbeitete Fassung in Michael Thompson, Life and Action, 2008; deutsch als: Leben und Handeln, 2011.
[6] 2011 S. 46ff.
[7] S. 65.
[8] S. 83.
[9] S. 96ff.
[10] S. 105.
[11] S. 101.
[12] Anton Leist (wie Fn. 4, S. 133) kritisiert, solche Teleologie sei im Rahmen der modernen Biologie seit Darwin eindeitig falsch und könne deshalb nur alltagssprachlich gemeint sein. Dagegen verteidigt Kietzmann das Konzept der Lebensform von Thompson und Foot als Redeweise, die auch vor dem Hintergrund er Evolutionstheorie angemessen bleibe (S. 185ff). Der Kritik von Leist könnte man begegnen, indem man die Spezies als System setzt und auf die Funktion der für relevant gehaltenenen Eigenschaften innerhalb einer Lebensform abstellt. Damit würde die »natürliche Normativität« allerdings zur bloßen Funktionalität, und es würde klar, dass Foot mit ihrer Redeweise schon den von Thompson apostrophierten »verborgenen normativen Unterbau« einzieht.
[13] Thomas Hoffmann/Michael Reuter, Auf dem Weg zum natürlich Guten Eine Einführung in die Moralphilosophie Philippa Foots, in: dies. (Hg.), Natürlich gut, Aufsätze zur Philosophie von Philippa Foot, 2010, 1-24, S. 13.
[14] Wie Fn. 3, S. 172f)
[15] Wie Fn. 4, S. 127.
[16] Dazu verweise ich auf Hellmuth Mayer, Die gesellige Natur des Menschen. Sozialanthropologie aus kriminologischer Sicht, 1977. Dieses Buch habe ich in mehreren Einträgen auf Rsozblog gewürdigt.